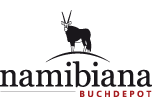| Untertitel: Grundzüge einer Geistes- und Kulturgeschichte der europäisch-überseeischen Begegnung
Autor: Urs Bitterli
Verlag: C. H. Beck
2., erw. Auflage, München 1991
Broschur, 14x22 cm, 498 Seiten, 7 sw-Abbildungen Die Kolonisation der Erde durch die Europäer vom 15. bis zum 18. Jahrhundert mit ihren tiefen Eingriffen in die politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der überseeischen Länder wird hier auf eindrucksvolle Weise dargestellt. Zugleich aber wird gezeigt, wie die Europäer selbst auf die Herausforderung antworteten, die die Begegnung mit der überseeischen Welt für sie bedeutete. Dabei wird ein Vorgang der Selbstbewußtwerdung der Europäer sichtbar, der zu den erregendsten in der Geistesgeschichte der Neuzeit gehört. Urs Bitterlis Buch, bereits ein Standardwerk der Kolonialgeschichte, wird hier, um einen Nachtrag erweitert, neu vorgelegt. “Eine Synthese dieser Art stand bisher aus, sie war nur zu leisten auf der Grundlage einer umfassenden Kenntnis der entsprechenden Quellen, und zwar sowohl derer, die primäre Wahrnehmungen aus Übersee nach Europa vermittelten, als auch derer, in denen sich die Verarbeitung dieser Nachrichten in Europa selbst spiegelte.“ Urs Bitterlis „Untersuchung stellt eine Leistung von hohem wissenschaftlichen Rang dar“. Eberhard Schmitt über die erste Auflage in der „Historischen Zeitschrift“. Urs Bitterli, geb. 1935, ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Zürich. Die Geschichte der europäisch-überseeischen Beziehungen ist bisher fast ausschließlich aus politischer und wirtschaftlicher Sicht dargestellt worden. Und dies mit guten Gründen: in der Tat stellt sich die „europäische Ausbreitung über die Erde“ seit ihren Anfängen im fünfzehnten Jahrhundert bis zum imperialistischen Zeitalter und darüber hinaus als ein monumentaler Prozeß menschlicher Machtentfaltung und Bereicherung dar. Daß die Haupttriebkräfte kolonialer Aktivität handfest materieller Natur waren, ist von den Beteiligten nicht geleugnet oder auch nur verschleiert worden; das Streben nach tatsächlichen oder gemutmaßten, offen zugänglichen oder zu erschließenden Schätzen erschien den Kolonisten in der Regel als natürliches und durchaus ehrenwertes Ziel nationalen Expansionsdranges und individueller Unternehmungslust. Spätestens im achtzehnten Jahrhundert, mit der Herausbildung der modernen Weltwirtschaft, begannen wirtschaftspolitische Überlegungen in weitausgreifender Verästelung die Entwicklung in und außerhalb von Europa zu beherrschen; globale Interdependenzen spielten sich ein und wurden durch Handels- und Zollabkommen international geregelt, während innenpolitisch diese Verflechtung im Bank-, Börsen- und Steuerwesen und in Gewerbe und Industrie sowohl im Mutterland wie in der Kolonie einen bestimmenden Ausdruck fand. Aber Kolonialgeschichte darf, will sie umfassend orientieren, nicht einzig und allein von Macht- und Interessenverlagerungen und den daraus resultierenden politischen, administrativen und ökonomischen Veränderungen handeln. Kolonialgeschichte ist auch die Geschichte vom Zusammentreffen von Völkern sehr verschiedener Kultur und Lebensform, von den inneren Spannungen, welche dieses Zusammentreffen ausgelöst hat, und von den Versuchen, diese Spannungen intellektuell zu bewältigen. Die Begegnung Europas mit der überseeischen Welt bedeutete zugleich immer auch eine gewaltige Herausforderung an den abendländischen Geist, an seine Aufnahmefähigkeit wie an seine ethische Substanz. Es ist Aufgabe dieses Buches zu zeigen, wie Europa auf diese Herausforderung bis zum Ende des achtzehnten Jahrhunderts geantwortet hat. Eine solche Darstellung der geistesgeschichtlichen Hintergründe der europäischen Kolonisation läßt sich auf verschiedene Art und Weise durchführen. Man könnte lediglich einen Teilaspekt, etwa die Frage der Beurteilung anderer Rassen durch die Gelehrten der Aufklärungszeit, einer detaillierten Prüfung unterziehen, und von daher vielleicht allgemeine Einsichten freilegen. Denkbar wäre auch, daß man von einer bestimmten These ausginge: so könnte man etwa am speziellen Beispiel der Mission zu zeigen suchen, ob, wie der Engländer Hobson bereits um 1900 vermutete, die kommerzielle Absicht im nachhinein die philanthropische überlagert; oder man könnte, gestützt auf das umfangreiche Quellenmaterial zur ersten Kulturberührung in Übersee, fragen, ob Margaret Mead mit ihren Theorien zum friedlichen Verhalten archaischer Völker Recht behält. Diesen Möglichkeiten des wissenschaftlichen Vorgehens wird hier eine weitere gegenübergestellt: die Synthese. Meine Absicht ist es, dem Phänomen der überseeischen Kulturbegegnung in möglichst vielen Bereichen der geistigen Auseinandersetzung nachzuspüren, bei den direkt Beteiligten und Betroffenen jenseits der Meere wie bei den Daheimgebliebenen, die darüber nachdachten. Diese Absicht zu verwirklichen ist ohne eine über den spezifisch historischen Bereich hinauszielende Betrachtungsweise nicht denkbar. So wurde es für mich unumgänglich, einerseits die politisch-wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen jener Auseinandersetzung im Auge zu behalten und ihr anderseits auf den verschiedensten Wissensgebieten, so etwa in der Geographie, der Völkerkunde, der philosophischen Anthropologie oder der Belletristik, zu folgen. Daß ich in den von mir jeweils berührten Fachgebieten nicht mit der vollen Kompetenz des Spezialisten arbeiten konnte, war kaum zu vermeiden; demgegenüber möchte ich jedoch hoffen, daß es mir gelungen ist, die Vielschichtigkeit und das Nebeneinander, zugleich aber auch die interdisziplinäre Kohärenz der europäischen Stellungnahme zur überseeischen Kulturbegegnung zu verdeutlichen, jene Totalität des intellektuellen Verhaltens also, die dem Gebildeten früherer Jahrhunderte weit bewußter war als dem hochspezialisierten Fachgelehrten unserer Zeit. Dem andern Anspruch, ein isoliertes Teilproblem oder den Nachweis einer These zum Gegenstand einer systematischen Untersuchung zu machen, war im Rahmen einer solchen Synthese nicht zu genügen; ich bemühte mich jedoch soweit irgend möglich, auf Fragen, wie die neueste Kolonialgeschichtsschreibung sie stellt, jeweils hinzuweisen. Gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt zeigen sich in diesem bislang so vernachlässigten Teilbereich der Geistesgeschichte interessante Forschungsinitiativen: so hat man sich etwa seit dem Erscheinen von Henri Baudets „Paradise on Earth“(London, 1965) vermehrt mit der Frage nach der stimulierenden Auswirkung des utopischen Denkens auf die Überseexpansion befaßt, und ein besonderer Wissenschaftszweig, die sogenannte „Imagologie“, beschäftigt sich seit kurzem damit, das „Eingeborenenbild“ des Europäers in
verschiedenen Epochen zu studieren. Zu meinem Bedauern habe ich vereinzelte wichtige Werke dieser Art nicht mehr berücksichtigen können; ich nenne hier zur Information des geneigten Lesers Elemire Zollas „Le chamanisme indien dans la literature americaine“ und das reichhaltige Werk „The Exploration of North America 1630-1776“ von W. P. Cummings und seinen Mitarbeitern. Wer als Europäer über Kolonialgeschichte schreibt, wird sich im klaren sein müssen, daß er dabei von einer Vergangenheit handelt, die noch zu „bewältigen“ ist - und nicht vom Europäer allein. Die vielerorts seit Jahrhunderten andauernden und oft sehr engen und tiefgreifenden Beziehungen zwischen Europa und seinen Kolonien haben archaische Kulturtraditionen zerbrochen oder modifiziert, Entwicklungstrends bestimmt, umwälzende Veränderungen ausgelöst, und wie auch immer dieser Prozeß bisher verlief - der Europäer ist an ihm beteiligt gewesen, hat Mitverantwortung zu tragen und wird von den zumindest im völkerrechtlichen Sinne unabhängig gewordenen Staaten der „Dritten Welt“ zur Rechenschaft gezogen. Die „koloniale Situation“ ist, wie der Tunesier Albert Memmi gezeigt hat, mit der „Dekolonisation“ nicht aus der Welt geschafft worden; das Spannungsverhältnis dauert an. Und auch der europäische Historiker bleibt diesem Spannungsverhältnis ausgesetzt. Von den Intellektuellen der ehemaligen Kolonialgebiete mit der Schuldfrage konfrontiert und zur Überprüfung seiner „europazentrischen Perspektive« aufgefordert, zugleich aber außerstande, über den eigenen Schatten zu springen, und verpflichtet, sich seiner eigenen Geschichtlichkeit zu stellen, sieht sich der Geschichtsschreiber bei der Sichtung und Wertung von Tatbeständen beständig zwei gegensätzlichen Gefahren ausgesetzt: der Selbstbezichtigung und der Selbstrechtfertigung. Wie delikat die Aufgabe des europäischen Historikers geworden ist, zeigt sich allein schon darin, daß viele Begriffe, die noch vor zwei Jahrzehnten zur Charakterisierung außereuropäischer Völker und Kulturen durchaus üblich waren, „Eingeborene“, „Neger“, „Stämme“, „Häuptling“, „primitiv“, „unterentwickelt“ etc., für das heutige Verständnis subtil diskriminierend wirken. Dieser Schwierigkeiten, die zwar Schwierigkeiten der historischen Erkenntnissuche überhaupt sind, bei einer Thematik wie der vorliegenden aber besonders akut in Erscheinung treten, bin ich mir bewußt gewesen. So war es mir etwa nicht möglich, eine „wertfreie Terminologie“ zu entwickeln; ich habe gewisse Sammelbegriffe wie „Eingeborene“ oder „Neger“, die in den Quellentexten vom fünfzehnten zum achtzehnten Jahrhundert übrigens oft ohne jede pejorative Absicht Verwendung fanden, wieder übernommen; und ich konnte nicht umhin, Wörter wie „archaisch“, „zivilisiert“, „natürlich“, „künstlich“ zu verwenden, obwohl mir klar ist, daß dadurch Dichotomien impliziert werden, die von der modernen Ethnologie zu Recht kritisch gesehen werden.
Ich bitte also, manche der von mir zum Teil aus rein stilistischen Erwägungen benutzten Begriffe als gleichsam behelfsmäßig akzeptieren zu wollen; im übrigen kann man ja auch derartig äußerliche Rücksichten zu weit treiben, und indem man die Juden als Israeliten und die Neger als Afrikaner bezeichnet, wird für das Verständnis der nationalsozialistischen Verfolgungen und des Sklavenhandels noch wenig gewonnen. Entscheidend ist doch wohl, daß es möglich wird, die Annäherung an bestimmte historische Tatbestände in einem Geist ideologiefreier Offenheit und Liberalität zu vollziehen, Proportion und Gewichtigkeit der jeweiligen Erscheinungen zur Evidenz zu bringen und dem Leser anhand der Vergangenheit eine Erfahrung zu vermitteln, die ihm vielleicht auch für seine Gegenwart noch hilfreich sein mag. Ob mir dies im Rahmen meiner thematischen Beschränkung einigermaßen gelungen ist, werden andere beurteilen müssen. |