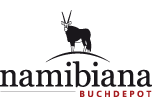Autor: Edith Werner
Christoph Links Verlag
Berlin, 2009
ISBN 978-3-86153-548-5
Klappenbroschur, 13x20 cm, 208 Seiten
Seit dem Ende der Apartheid ist Südafrika zu einem Magneten für Afrikabegeisterte geworden. Felsküsten, Sandstrände, Weinberge und eine einzigartige Tierwelt locken Touristen.
Mancher kommt als Besucher und bleibt. Allein um Kapstadt herum haben sich mehr als 90.000 Deutsche niedergelassen. Edith Werner hat fünf Jahre in Kapstadt gelebt und Südafrika intensiv bereist.
Sie schreibt über die Spontaneität, die Offenheit und den Optimismus der Menschen, verschweigt aber auch nicht die Herausforderungen im täglichen Miteinander eines Landes, das eine schwierige Geschichte zu bewältigen und mit Armut, Gewalt und Aids zu kämpfen hat.
Ein persönliches Landesporträt ist entstanden, das vielfältige Einblicke in Geschichte, Politik, Gesellschaft und Kultur vermittelt und die Südafrikaner selbst zu Wort kommen lässt.
Oliver Gerhard, Süd-Afrika
In ihrem Buch zeigt sich die Autorin nicht nur als Landeskennerin, sondern auch als sensible Beobachterin. Unterhaltsam schildert sie viele Besonderheiten des südafrikanischen Alltags wie die Lektionen in der Kunst der Improvisation oder der Etikette beim Braai. Sie beschäftigt sich mit der wechselvollen Geschichte und der Kulturszene. Die Probleme des Landes kommen dabei nicht zu kurz.
Edith Werner. Geboren in Berlin; Studium der Literaturwissenschaft und Geschichte; Lehrtätigkeiten an den Universitäten Kairo und Heidelberg; anschließend Leiterin einer international aktiven Unternehmensstiftung im Ruhrgebiet; fünfjähriger Aufenthalt in Südafrika, dort zeitweilig ehrenamtlich für eine deutsche Entwicklungseinrichtung tätig; lebt heute in Argentinien. Veröffentlichungen zum europäischen Bildungswesen und zu Afrika.
Vorwort
Ein Stück Europa in Afrika
Sprechende Namen - Treu und fest - Alter und neuer Wein - Very British - Jüdische Diaspora - Das Staatsvolk
Von Buschmännern, Khoikhoi, Nguni, Holländern und Engländern - Südafrikas Kolonialgeschichte
Mynheer van Riebeeck trifft Autshumato - Buschmanngeschichten - Mrs. Pies, das goldene Nashorn und die Ahnen - Europäischer Stabwechsel - Der große Treck - Nongqawuse hat eine Erscheinung - Allerlei Kriegsschauplätze - Shaka Zulu - Gold! - Boer & Brit - Erstmals vereint - Exkurs: Deutsch-Südwest
Der süße Duft der Freiheit - Entstehung und Überwindung der Apartheid
Gefängnisoper - Die Anfänge des ANC - Die Nats festigen sich - Apartheidstrategien - Schwarzer Widerstand - Gefangen in der Wagenburg - Mandela frei! - Bausteine des neuen Südafrika
Wer ist ein Afrikaner? - Mehrheit und Minderheiten
I am an African - Onse mense/Our people - Proudly South African
Jenseits des Regenbogens - 15 Jahre nach dem Aufbruch
Mind the gap! - Gewalt und Ratlosigkeit - ANC & BEE - Kap der Guten Hoffnung?
Black is beautiful - Kultur im neuen Südafrika
Kino und Theater afrikanisch - Ländliche Feste: früher zum Nagmaal, heute zum Kulturfestival - Das Bild des Menschen - Schwarzer Rhythmus
Die Schöne und die Reiche - Kapstadt und Johannesburg
Altes und Neues in der "Mother City" - Im Township - Insel am Kap - Stadt des Goldes - Afrikanische Metropole - Schlüsselerlebnisse
Alltägliches Südafrika - Vom Wohnen, Arbeiten, Reisen und Genießen
Das Schauhaus der Woche - 'N boer maak 'n plan - Vom lieben Geld - Learning by doing - Gesundheit! - "Cape Doctor" und andere Wetterlagen - Viele Köche - An den Feuern des braai - Wein oder Whisky? - Staatsaffäre Sport - Mein Gott, dein Gott - Shop till you drop - Im Yuppieland - Stop and go - Weihnachten steht vor der Tür
Eine Hauptrolle der Natur
The Great Outdoors - Wirtschaftsfaktor Tourismus - Rind oder Büffel? - Naturparks ohne Grenzen
Platzhirsch Südafrika
Südafrikas Bild in Afrika - Politischer Führungsanspruch - Wirtschaftliche Überlegenheit - Refugium
Die Welt zu Gast- Die Fußballweltmeisterschaft 2010
Ein Modell für Afrika - "Bafana Bafana" - Größer, schöner, weiter - Transport und Sicherheit
Nachwort
Anhang
Anmerkungen
Literatur, Film, Musik
Informationen in Internet und Printmedien
Abbildungsnachweis
Glossar
I am an African - Onse mense / Our people - Proudly South African
I am an African
"I am an African", so stellte sich der junge ANC-Exil-Politiker Thabo Mbeki 1987 in Dakar bei dem ersten Treffen von weißen oppositionellen Südafrikanern aus Politik und Publizistik mit ANC-Leuten vor. "I am an African", leitete er neun Jahre später als Vizepräsident von Südafrika seine Rede zur feierlichen Annahme der neuen Verfassung im Parlament ein.
Bei der deutschen Übersetzung fängt die Begriffsverwirrung an, denn den "African" trennt nur ein kleines c vom Afrikaner, wie sich die Europäer Südafrikas nennen, soweit sie afrikaanssprachig sind. Im Deutschen übersetzen wir "African" mit Afrikaner und "Afrikaner" mit Bure. In seiner Verfassungsrede gebrauchte Mbeki "African" in umfassender Bedeutung. Das c und das k machten noch keinen Unterschied:
"Ich bin ein Afrikaner [...]. Ich verdanke meine Existenz den Khoi und San, deren verlorene Seelen die Weiten des schönen Kaps heimsuchen [...]. Ich bin geprägt von den Einwanderern, die Europa verließen, um in unserem Geburtsland eine neue Heimat zu finden [...]. In meinen Adern fließt das Blut malaiischer Sklaven, die aus dem Osten kamen [...]. Ich bin der Enkel der kriegerischen Männer und Frauen, die Hintsa [...], Cetshwayo [...] und Moeshoeshoe führten [...].
Ich bin der Enkel, der Blumen auf die Burengräber von St. Helena und den Bahamas legt [...]. Ich bin das Kind von Nongqawuse [...]. Ich stamme von denen, die aus Indien und China hierher verfrachtet wurden [...]. Als Teil all dieser und in der Gewissheit, dass niemand diese Feststellung in Zweifel zu ziehen wagt, beanspruche ich, ein Afrikaner zu sein [...].
Die Verfassung, deren Annahme wir feiern, begründet und stellt unwiderruflich fest, dass wir es ablehnen hinzunehmen, dass unser Afrikanertum durch Rasse, Farbe, Glauben, Geschlecht oder historisches Herkommen bestimmt werde. Sie ist ein überzeugtes Bekenntnis, dass Südafrika allen gehöre, die in ihm leben, schwarz und weiß."
Mittlerweile ist viel von dem Idealismus der ersten Jahre verloren gegangen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Ernüchterung des täglichen Miteinanders setzte ein. Die Versuchung, für viele Probleme des Landes den einen großen Sündenbock in Apartheid und Rassismus zu finden, ist groß, und die Lust an der Macht auf Kosten der Vielfalt wächst in der Regierungspartei.
Bereits 2006 wurde eine Regelung wieder eingeführt, die fatal an Apartheidzeiten erinnert. Bei Stellenbewerbungen im öffentlichen Dienst, allen parastaatlichen Einrichtungen und bei der Einschulung muss wieder die Rasse angegeben werden. Auch bereits Beschäftige sind aufgefordert, in ein Formular ihre Rasse einzutragen, "African", "Coloured", "Indian" oder "White". Millionen von Arbeitnehmern sind betroffen.
Nur wer schwarz ist, kann nach dieser Klassifikation ein "African" sein. Die alten trennenden Begriffe geistern ohnehin noch in allen Köpfen herum. Meine Xhosa-Lehrerin Pumzile erzählt lachend von einer Fernsehsendung, in der ein ziemlich Dunkelhäutiger, der sich in den alten Zeiten als "Coloured" ausgegeben habe, weil seine Mutter eine Farbige sei, nun ein "African", also ein Schwarzer, sein wolle.
Für sie, die Xhosa, ist es selbstverständlich, dass "African" nur sein kann, wer schwarz ist. Frühere Antiapartheidkämpfer wie van Zyl Slabbert und Alan Boesak warnen vor einem neuen Rassismus und weigern sich, sich selbst zu klassifizieren, oder nennen sich in Fragebögen einfach Afrikaner.
Auf der Suche nach Licht im Dunkel der südafrikanischen Sprachverwirrung lausche ich im Juni 2004 der Rede des damals noch amtierenden City Managers von Kapstadt und frühen Vorsitzenden der Kommission für Landumverteilung, Wallace Mgoqi. Er verspricht auf die Frage "Who is an African?", so der Titel seines Vortrags, eine Antwort zu geben.
Nicht nur, dass der promovierte Jurist Mgoqi seine Gelehrsamkeit ausführlich zur Schau stellt und des längeren im Predigerton allerlei Zelebritäten von Thabo Mbeki bis zu Patrice Lumumba und selbst Paul Krüger zitiert, macht seinen Vortrag unbefriedigend. Auch auf die Frage erhalte ich eine recht einseitige Antwort. So lerne ich, dass viele Größen der Vergangenheit und Gegenwart Afrikaner seien. Einige davon leben allerdings nicht in Afrika. Martin Luther King gehört dazu.
Andere wieder sind Afrikaner, weil sie einmal hier gelebt haben, wie Mahatma Gandhi. Jan van Riebeeck oder Jan Smuts gehören nicht in den Kreis der Erwählten, obwohl sie auch hier gelebt haben. Ansonsten erfahre ich, dass wir in das "African Century" eingetreten sind. Was immer das auch beinhalten mag, Mgoqi lässt keinen Zweifel daran, dass er Südafrika als Modell für das restliche Afrika begreift.
Eine lebhafte Diskussion schließt sich an Mgoqis Vortrag an. Die meisten Beiträge sind zustimmend, vor allem zum "African Century" und zur Führungsrolle Südafrikas. Bei allen Diskussionsveranstaltungen fällt die Neigung zu verbaler Harmonie auf. Man ist immer nett zueinander, was ein angenehmes Klima schafft, aber zur Klärung von kontroversen Fragen oft wenig beiträgt. Im Zweifelsfall hilft es, von Ubuntu zu sprechen, von diesem afrikanischen Zauberwort für Gemeinschaft.
Ich fühle mich dann sehr europäisch-überkritisch, wenn ich ganz heimlich denke, das ist zu schön, um wahr zu sein. Als ich in der Kaffeepause einige Teilnehmer frage, warum alle so deutlich um Harmonie bemüht seien, murmelt jemand: "Man will schließlich nicht als Rassist verteufelt werden." Das große Tabu. Angenehm fällt mir auf, dass die bei uns so häufige Verbissenheit fehlt. Man redet miteinander, und es darf auch gelacht werden. Bei manchen klingen der vorgezeigte Optimismus und das emphatische Einstimmen ins Credo des afrikanischen Jahrhunderts eher wie Rufen im finsteren Walde.
Ein paar Beiträge lassen jedoch anklingen, dass die ständige afrikanische Nabelschau zu nichts führe und man sich besser den drängenden gesellschaftlichen Problemen widmen solle. Ein junger Schwarzer stellt fest, man müsse nicht darüber diskutieren, wer ein Afrikaner sei. Bei ihm sehe man es an der Hautfarbe, egal wo auf der Welt er sich befinde. Ein aus Tschechien stammender Historiker macht darauf aufmerksam, dass die Begriffe Afrika und afrikanisch nicht auf dem Kontinent selbst, sondern von den Römern erfunden worden seien. Die Afrikaner hatten kein übergreifendes Bild von sich selbst gehabt.
Sie seien Zulu, Xhosa, Sotho usw. gewesen. Sollte erst der forschende, ordnende, auch erobernde Geist von Europäern den Begriff gebracht haben? Das wird in dieser Phase des noch jungen, empfindlichen Selbstbewusstseins schwer zu akzeptieren sein. Die Identitätsfrage treibt alle um.
Die großen Blätter widmen ihr regelmäßig Artikelserien und in den umfangreichen Leserbriefspalten ausgetragene Debatten. Alle sind Experten, auch wenn sie nicht professionelle Imagepfleger sind wie Solly Moeng, der Südafrika in den USA touristisch vermarktet hat und in der Cape Times einmal mehr die Frage aufwarf, "was es bedeutet, ein [schwarzer] Afrikaner in Südafrika zu sein."
Bei den schwarzen Intellektuellen mahnte er mehr Courage an, Tabus zu brechen und unbequeme Fragen zu stellen. Auch bei anderen Benennungen verliert man sich leicht im Gestrüpp alter und neuer Abgrenzungen. Irgendwann sind alle nach Südafrika, besonders ins Kapland, zugewandert. Nur die Buschmänner und Khoikhoi waren schon immer da. Kaum jemand wagt noch von Buschmännern zu sprechen, wenn er sich nicht als abständig oder gar rassistisch outen will. Aber auch hier wogt der Namensstreit.
Der Direktor der Iziko-Museen Kapstadts, zu denen auch das völkerkundliche Museum gehört, vertritt die Meinung, die Bezeichnung "San" sei abwertend, denn sie bedeute Räuber oder Mörder. Die Betroffenen selbst wussten das anscheinend schon, denn ein Sprecher der sogenannten Khoi-San im Namaqualand bestand darauf, dass sie Boesmanne, "Buschmänner" seien. So werden sie auch in Botswana genannt, das die größte Population hat, ohne dass jemand Anstoß nähme. Aber das ist doch eine europäische Benennung?
Das mag sein, es steht jedoch zu vermuten, dass angesichts der Kleinteiligkeit der frühen Gesellschaften und der Vielzahl der Sprachen auch für diese Menschen gar kein übergreifender Begriff existierte. Bei Wilhelm Bleek, der sich am eingehendsten mit Kultur und Sprache der Buschmänner beschäftigt und ihre Sprache und Mythen aufgezeichnet hat, hören wir nichts von San. Out ist vorerst auch die Bezeichnung Hottentotten für Khoikhoi.
Schwarz wird gern als politischer Begriff verwendet. Selbst ein Chinese kann in diesem Verständnis schwarz sein. Kämpferische Inder und Coloureds bezeichnen sich selbst als schwarz. Schwarze "Eingeborene" zu nennen wäre dagegen fatal. Nur sie selbst dürfen das.
2006 ging ein Aufschrei durch die Zeitungen, als sich in Johannesburg ein Native Club gründete, zu dessen Selbstverständnis es gehört, dass nur Schwarze, natürlich nur solche mit Einfluss und Geld, mitmachen dürfen; wie in den schlechten alten Zeiten des Broederbond, des Klubs weißer Afrikaner, nur mit umgekehrtem Vorzeichen. Die politisch korrekte Begrifflichkeit ist eine hohe Kunst, und immer ist ein Fettnäpfchen nahe.
Onse mense/Our people
Die Regenbogennation bleibt eine Hoffnung. Noch ist die südafrikanische Gesellschaft fragmentiert. Das Abgrenzungsbedürfnis scheint eher zu- als abzunehmen. Konnte man 1994 noch die neue Nationalhymne einfach aus der Verbindung einer Xhosa-Zulu-Hymne, die zum Kampflied geworden war, mit dem Preislied der Afrikaner auf ihr schönes Land und einer englischen Strophe komponieren, so wäre das heute kaum noch denkbar.
"Nkosi sikelel'i Afrika", "Herr segne Afrika", und "Uit die blou van onse hemel", "Aus dem Blau unseres Himmels", gehen nicht mehr so leicht zusammen. Das letzte Versöhnungsbarometer, vom Institute for Justice and Reconciliation regelmäßig veröffentlicht, zeigte Ende 2007, dass die Anzahl der Befragten, die angeben, gesellschaftlichen Kontakt zu Mitgliedern einer anderen Bevölkerungsgruppe zu pflegen, innerhalb der letzten fünf Jahre um 10 Prozent auf 48 Prozent abgenommen hat.
Als ein englischer Kommunalpolitiker, der sich jedes Jahr als ein anderer Prominenter verkleidet, sich schwarz angemalt und Nelson Mandela dargestellt hatte, wurde in England und in Südafrika gleich Rassismus geschrien. Nur Mandela selbst blieb gelassen. Er fand es lustig. Diese Souveränität ist in der Zeit des Machterhalts und -ausbaus nicht mehr verbreitet.
Auch die Buren haben den ersten Schock des Machtverlusts, der sie stumm gemacht hat, überwunden und bekunden lautstark ihre Afrikaneridentität. Vor allem junge Menschen, deren berufliche Zukunft angesichts von Affirmative Action, der bevorzugten Einstellung Schwarzer, nicht rosig aussieht, pflegen Afrikanerromantik. So jubeln sie einem Sänger zu, der einen alten Burenkriegsgeneral ausgegraben hat und ihn als Helden wiederhaben möchte.
Wo das Lied "De la Rey, de la Rey, willst du kommen und die Buren führen?" gesungen wird, zieht es Massen an. In Stellenbosch gingen die Studenten der Universität auf die Straße und demonstrieren für ihre taal, ihre Sprache. Nicht mehr alle wollen englischer sein als die Engländer oder mehr African als Xhosa, Zulu und Sotho.
Bei der Aufführung des Stücks Fielas Kind in Kapstadts Artscape-Theater über eine farbige Frau, die einen weißen Jungen aufzieht, bekannte der Hauptsponsor, die "Afrikaanse Taal en Kultuur Vereeniging", in einer Ansage vor Beginn "Ons is trots suidafrikaans in afrikaans". Auf Afrikaans will man ein stolzer Südafrikaner sein.
Das romantisierte historische Erbe wird von allen Bevölkerungsgruppen gepflegt. Was für die Afrikaner "onse mense", unsere Menschen, sind, ein Begriff, der das ganze Afrikanertum umfasst, samt Sprache, Kirche, Gründungsmythen, Burenkrieg und Brauchtum, ist für die Xhosa und Zulu "our culture", wozu vor allem Ahnenverehrung, Initiation und Heiratsriten gehören.
Wann immer mir meine Haushaltshilfe Nomsa vom Bierbrauen anlässlich einer Beerdigung, von der Lobola, die sie für die Verheiratung ihrer Nichte erwartet, erzählt oder für einen Trauerfall bei fernen Verwandten in Kimberley freihaben möchte, versichert sie mir, es handle sich um "our culture".
Englischstämmige haben keinen vergleichbaren Sammelbegriff. Immerhin, das Empire ist zwar vergangen, aber Shakespeare, London und das englische Königshaus sind ihnen geblieben. Die Cape Times lässt auch den geringsten Anlass nicht vorbeigehen, ohne ihre Leser über die Queen und die königliche Familie ins Bild zu setzen. Zum allsommerlichen Shakespeare-Stück trifft sich die englischstämmige Gemeinde im lauschigen Park des May-nardville-Theaters in Wynberg.
Ein betagter Bekannter, der in der dritten Generation Südafrikaner ist, unterhielt mich einen ganzen Abend lang mit den verschiedenen Theorien über die Identität Shakespeares und bekannte, er sei Francis Baconianer - also Anhänger der Variante, dass der Lordkanzler der Urheber der Stücke sei - wie schon seine Mutter in ihren Londoner Jugendtagen. Jeder hat einen Verwandten, der gerade in London ist oder bald einmal dorthin will.
Am schwersten haben es die Farbigen mit ihrer Identität. Im Westkap sind sie eine Mehrheit von 85 Prozent, in ganz Südafrika eine Minderheit von knapp neun Prozent. Ethnisch repräsentieren sie die Regenbogennation am besten. Sie sind äußerlich am verschiedenartigsten. Khoikhoi, Malaien, Bantu und Europäer haben zu ihrer Mischung beigetragen.
Im Namaqaland, im wüstenhaften Nordwesten, klein und zierlich mit runden Köpfen, runzligen Gesichtern und hohen Wangenknochen, in Kapstadt mit malaiischem oder indischem Einschlag, ansonsten in allen Schattierungen von Fastschwarz bis Beinaheweiß. Ihre Sprache ist Afrikaans, ihre Kirche, bis auf die kleine muslimische Gruppe der Kapmalaien, ist die der Holländer.
Weil aber die kalvinistische Hauptkirche mit der Apartheid ging, hatten die Farbigen bis vor kurzem ihre eigene Kirche, die Sendelingskerk oder Missionskirche. Erst 2007 haben die beiden Kirchen beschlossen, sich zu vereinigen. "Die sind ja wie wir", sagen heute viele Weiße, besonders diejenigen, die Vorbehalte gegen Schwarze haben. "Die sind ganz anders als wir", sagen die meisten Schwarzen. So fühlen sich viele Farbige als Sandwich-Bürger, eingeklemmt zwischen alter und neuer Oberschicht. Schon die vielen Bezeichnungen und Spitznamen deuten ihre schwierige Position an:
"Farbiger
Das Wort ist passe ...
Farbig rein
Farbig raus
Was soll's
Sogenannter
Kleurling
Amakadali
Busbi
Euro-African
St. Helenan
Mixed
Mauritian
Malay
Korrelkop
Kroeskop
Darkie
Play'-white
Other Coloured
Cape Coloured
Bastard
Bruinou
Bushak
Khoi-Khoi
San
Gazi
Outie
Stekkie
high tie
Bra!..."
Die meisten Farbigen selbst möchten heute "trotse kleurlinge", stolze Farbige, sein, fühlen sich politisch und ökonomisch aber an die Seite gedrängt. Nur wenigen gelingt es, eine struggle-Dividende einzufahren, wie Cheryl Carolus, der Ex-Botschafterin in London, die seitdem Aufsichtsratsposten sammelt, Jakes Gerwel von Media 24, dem Wirtschaftsboss Gavin Pieterse oder dem Kanzler der Universität Stellenbosch Russell Botman.
Farbige in herausgehobenen Positionen sind eher die Ausnahme. Am weitesten haben es Ex-Westkap-Premier Ebrahim Rasool und Finanz- beziehungsweise Planungsminister Trevor Manuel gebracht. Manuels Metamorphose vom blutüberströmten Demonstranten zum kompetenten obersten Finanzchef und Haushaltssanierer wird allgemein bewundert.
In Kapstadt ist die Gruppe der Kapmalaien prominent vertreten. Die muslimischen Nachkommen von Sklaven, die die holländische Ostindienkompanie aus Batavia herbrachte, haben eine eigene Identität bewahrt. Ihr Wohnviertel Bo-Kaap, das Oberkap am Abhang des Signal Hill, gehört mit seinen bonbonfarben angestrichenen Häuschen, den kopfsteingepflasterten Straßen und verschwiegenen Innenhöfen zu den attraktivsten Vierteln der Stadt. Ihr dicht geknüpftes soziales Netz und der Einfluss eines gemäßigt auftretenden Islams haben diese Gemeinde von Farbigen über Jahrhunderte zusammengehalten.
Die kleinste und, zusammen mit den Englischstämmigen, historisch jüngste Einwanderergruppe sind die Inder. Sie sind zum großen Teil wirtschaftlich erfolgreich, besonders die indischen Muslime, und politisch meistens zurückhaltend. Kulturell bilden sie eine eng verwobene Gemeinschaft. Ihr Bezugsland bleibt Indien. Ihre Sprache ist Englisch.
Selbst in Kapstadt, das eine vergleichsweise kleine indische Gemeinde hat, gibt es ein Kino im großem Einkaufs- und Vergnügungszentrum Century City, das regelmäßig indische Bollywoodfilme zeigt. In Durban ist der indische Einfluss am größten. Nicht nur der Gewürzmarkt im alten Bazargebäude gibt der Stadt am Indischen Ozean ein orientalisches Flair.
Proudly South African
Allen Südafrikanern gemeinsam, wenn auch aus unterschiedlichem Blickwinkel, ist die Begeisterung für die Schauplätze und Helden vergangener Schlachten. Alle teilen auch einen unverstellten, oft rührenden Nationalstolz, der die vielen Gegensätze auf wunderbare Weise überbrückt. Man ist überzeugt davon, im schönsten Land, in der schönsten Stadt der Welt zu leben.
Als Menschen aller Schichten, Farben und Altersgruppen anlässlich der großen Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des neuen Südafrikas über ihr Land befragt wurden, sagten mehr als vier Fünftel, sie fühlten sich glücklich, Südafrikaner zu sein, und sie seien mit ihrem Leben zufrieden. Das schließt einen großen Teil der Armen, Arbeitslosen, Aidskranken ein.
Als Deutschland 2006 bei der Fußballweltmeisterschaft erstmals etwas unbefangener und gelöster mit seinem Nationalgefühl umging, verstand man hier gar nicht, dass dies etwas Besonderes sei. Bei gemischt deutsch-südafrikanischen Anlässen wie dem Empfang des Generalkonsulats zum deutschen Nationalfeiertag, singen die paar anwesenden Südafrikaner ihre Hymne, wenn auch jede Gruppe ihre Strophe, lauter und mit mehr Inbrunst als die vielen Deutschen die ihrige.
Bei öffentlichen Anlässen wird das Bild von der Regenbogennation weiter gepflegt. Zur alljährlichen feierlichen Eröffnung der Sitzungsperiode des Parlaments in Kapstadt kommen die Abgeordneten in Tracht. Da kann man die phantasievollsten Kostüme bewundern. Beleibte Xhosa-Damen leuchten in kräftigem Orange mit passendem Turban. Selbst Leopardenfelle auf entblößter männlicher Zuluschulter wurden schon gesehen.
Als die Inderin Frene Ginwala noch dem Parlament präsidierte, erschien sie im schön gemusterten Sari. In einem Jahr fügte eine zarte, blonde Afrikaner-Abgeordnete im Blümchenkleid und züchtiger Haube der Burenfrau von einst dem Regenbogen eine weitere Schattierung bei. Mandelas Afrohemden haben Mode gemacht. Nur Thabo Mbeki, der Anglophile, trat immer im gedeckten Zweireiher mit Weste auf, und die einstige First Lady Zandile begleitete ihn im schicken westlichen Oufit, der aber "proudly South African" hergestellt war.
"Proudly South African", diese Werbekampagne der Wirtschaft, schuf ein Markenzeichen wie "Made in Germany". Wenn auch weiterhin die meisten T-Shirts und Mobiltelefone aus China kommen, der Begriff blieb hängen und wird mit Stolz gebraucht. Der unbefangene Patriotismus mag auch helfen, eines Tages die Rassenschranken zu überwinden.
Schon jetzt mischt sich, was zusammengehört, vor allem unter jungen Menschen. Einige Wochen lang war ich regelmäßige Besucherin der Universität Kapstadt. Da fühlte ich mich in Cafeteria, Bibliothek, Vorlesungsräumen, und erst recht auf den Sportplätzen, in ein zukünftiges Südafrika versetzt, das den Regenbogen vielleicht wieder mit mehr Berechtigung als Emblem verwenden kann.