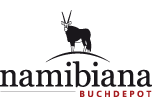Originaltitel: Out of the Shadows
Übersetzung: E. Vorspohl
Wahrheits- und Versöhnungskommission Südafrika (Hg.)
Verlag: Brandes & Apsel
Frankfurt, 2000
Broschur, 15x21 cm, 400 Seiten, 110 Fotos
Nach dreijähriger Arbeit übergab Erzbischof Desmond Tutu im Oktober 1998 dem ersten demokratisch gewählten Präsidenten Südafrikas Nelson Mandela den 3.500 Seiten umfassenden Bericht der Wahrheits- und Versöhnungskommission. Darin werden die Verbrechen der Apartheidära bis zu den ersten demokratischen Wahlen 1994 dokumentiert. Aus diesem »Testament« haben Mitglieder der Kommission eine »popular version« für das südafrikanische Volk verfaßt. Sie liegt hier in deutscher Sprache unter dem Titel „Das Schweigen gebrochen“ vor. Das Buch zeigt, welche Aufgaben sich die Kommission gestellt hat, welche Wahrheiten sie aufdeckte und zu welchen Schlußfolgerungen sie gelangte. Es zeigt aber auch, mit welch hohem Maß an Idealisierung und Überforderung die Kommission zu kämpfen hatte und wie es gelungen ist, den Selbstreflexionsprozeß als notwendige Bedingung für Versöhnung in Gang zu bringen. Im Mittelpunkt stehen die Anhörungen verschiedener Gruppen von Opfern. Transparent werden die Produktion von Terror durch den Apartheidstaat und die Verstrickungen der politischen Parteien in das Gewaltregime. Die Amnestie-Anhörungen geben einen Einblick in die Abgründe der Täterseite und die Praxis von Entführung, Folter und Mord unter der Apartheid. Das Buch dokumentiert aber auch Empfehlungen der Kommission zur Frage der Wiedergutmachung und Entschädigung der Opfer und zeigt Perspektiven auf für die Wiederherstellung von Menschenrechten. Im internationalen Vergleich stellt die südafrikanische Wahrheits- und Versöhnungskommission den bisher umfassendsten und gelungensten Versuch dar. Verbrechen eines brutalen menschenverachtenden Systems aufzuarbeiten und durch eine gemeinsame Erinnerung die Basis für einen tragfähigen Versöhnungsprozeß zu legen. Der Fototeil enthält beeindruckende Zeugnisse der Apartheidära und eindringliche Bilder der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika. »... ein erschütternder und bewegender Bericht über eine menschenverachtende Vergangenheit und den Versuch, diese aufzuarbeiten. Der Prozess, den die Wahrheitskommission angestoßen hat, bedeutet die südafrikanische Geschichte neu zu schreiben und einem Hoffnungsfunken für eine neue Gesellschaft zu entfachen.«(ai-Journal)
»Jahrzehntelang wurde die südafrikanische Geschichte von einem tiefen Konflikt zwischen einer Minderheit, die sich die gesamte Kontrolle vorbehielt ..., und einer Mehrheit beherrscht, die sich dieser Unterdrückung zu widersetzen versuchte. Diesem Konflikt fielen die menschlichen Grundrechte zum Opfer ... die Legitimität des Rechtes selbst wurde zutiefst verletzt, während das Land angesichts dieses tragischen Konfliktes verblutete.«
Ismail Mahomed, Vizepräsident des Verfassungsgerichts Als sich die am südafrikanischen Konflikt beteiligten Parteien an einem Tisch zusammensetzten, um den Übergang zur Demokratie auszuhandeln, waren viele Menschen der Meinung, daß das Land jeden, der sich an grausamen Verbrechen beteiligt hatte, vor Gericht stellen sollte, so wie es nach dem Zweiten Weltkrieg in den Nürnberger Prozessen geschehen war. Die tatsächliche Lösung aber gestaltete sich komplizierter. In Südafrika hatte es keinen klaren militärischen Sieg gegeben. Deshalb waren die Befreiungsbewegungen nicht in der Position, ohne weiteres das Recht des Siegers durchzusetzen. Zudem bestand die Gefahr, daß die Mitglieder der ehemaligen staatlichen Sicherheitskräfte die Verhandlungsvereinbarungen nicht anerkennen und das Land in einen Bürgerkrieg stürzen würden, wenn sie mit Anklagen hätten rechnen müssen. Eine Nation, die unter der Herrschaft eines Unterdrückungsregimes gespalten wird, kann sich nicht plötzlich als Einheit erleben, sobald die Zeit der Unterdrückung vorüber ist. Ein Bürgerkrieg oder eine massive Destabilisierung der neuen Ordnung wäre sogar nach Abschluß der Verhandlungen noch möglich gewesen (in KwaZulu-Natal ist es tatsächlich soweit gekommen). Eine solche Möglichkeit schwebte Richter Ismail Mahomed vor, als er Marvin Frankel, Richter der Vereinigten Staaten, zitierte: »Wenn die Armee und die Polizei Handlanger des Terrors waren, dann werden sich die Soldaten und die Polizisten nicht über Nacht in Musterbeispiele für die Respektierung der Menschenrechte verwandeln. Wenn sie zu hart behandelt werden - oder wenn das Netz der Bestrafung allzu weit gespannt wird -, kann es einen Rückschlag geben, der ihnen in die Hand spielt. Aber ihre Opfer können nicht einfach vergeben und vergessen.« Den Nürnberger Weg nicht einzuschlagen war eine schwierige Entscheidung, besonders für die Angehörigen der Befreiungsbewegungen; vielen von ihnen war nur allzu bitter bewußt, in welch hohem Maße Mitglieder und Anhänger der Apartheidregierung Menschenrechtsverletzungen begangen hatten. Der Führer des African National Congress (ANC), Thabo Mbeki, hat dies folgendermaßen formuliert: »Innerhalb des ANC forderte man lautstark: „Fangt die Bastarde und hängt sie.“ Uns wurde jedoch klar, daß man nicht gleichzeitig einen friedlichen Übergang vorbereiten und sagen kann, daß man Leute fangen und hängen will. Daher haben wir für den friedlichen Übergang einen Preis gezahlt.« Ein weiterer Grund, weshalb Prozesse nach Nürnberger Vorbild keine realisierbare Möglichkeit darstellten, war die Tatsache, daß Südafrika für ein solches Verfahren weder die Zeit, das Geld noch das Personal hatte. Es hat zum Beispiel über 18 Monate gedauert, bis im Prozeß gegen Colonel Eugene de Kock, den ehemaligen Kommandeur der Viakplaas - einer Abteilung der Sicherheitspolizei, die für zahlreiche Morde und Geheimoperationen verantwortlich war - ein Urteil gesprochen wurde. Die Verhandlung, der bereits mehrjährige Untersuchungen vorausgegangen waren, kostete die Steuerzahler 5 Millionen Rand. (Wenn es sich bei den Angeklagten um ehemalige Staatsangestellte handelt, muß der Staat die Kosten für ihre Verteidigung tragen.) Selbst wenn eine Strafverfolgung politisch machbar gewesen wäre, hätte man daher lediglich einen Bruchteil der Täter, die sich schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig gemacht hatten, vor Gericht stellen können. Darüber hinaus stützen sich Strafverfahren auf Beweise, die über jeden Zweifel erhaben sind, und das Strafrechtssystem stellt den Tätern keinen Anreiz in Aussicht, die Wahrheit zu sagen. Solche Strafverfahren sind für die Opfer, die häufig ausführliche und traumatische Kreuzverhöre über sich ergehen lassen müssen, quälende Erfahrungen. Und man sah auch die Gefahr, durch mehrjährige Anhörungen über Ereignisse, die intensive Gefühle wecken, allzu lange eine traumatische Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Diese Befürchtungen veranlaßten die Verhandlungspartner, sich auf zwei Grundsätze zu einigen. Es sollte zum einen keine Prozesse nach Nürnberger Vorbild geben, und zweitens sollte eine bestimmte Form der Amnestie für politisch motivierte Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden waren, in Aussicht gestellt werden. Nun gab es zwei Möglichkeiten: eine Generalamnestie oder eine Wahrheitskommission. Die frühere Regierung bestand auf einer Generalamnestie, die von den anderen Verhandlungsparteien jedoch abgelehnt wurde. Eine pauschale Amnestie bedeutete ihrer Meinung nach, einfach zu vergeben und zu vergessen, und dies hielten sie für unannehmbar. Die Vergangenheit auf sich beruhen zu lassen hätte bedeutet, sich mit einer landesweiten Amnesie einverstanden zu erklären - die den Opfern der Gewalt ihr Recht verweigert hätte, ihre Geschichte zu erzählen. Der erste Ruf nach einer südafrikanischen Wahrheitskommission kam aus den Reihen der ANC-Führung. Professor Kader Asmal sagte in einer Rede, die er 1992 an der University of the Western Cape hielt: »Wir müssen die Vergangenheit ernst nehmen, weil sie den Schlüssel zur Zukunft birgt. Die Probleme der strukturellen Gewalt, der ungleichen Besitzverteilung und ungerechten ökonomischen Verhältnisse und einer ausgewogenen künftigen Entwicklung sind ohne ein bewußtes Verständnis der Vergangenheit nicht wirklich zu lösen.« Professor Asmals Appell gab den Anstoß zu einem formalen Antrag des nationalen ANC-Vorstandes auf Einberufung einer Wahrheitskommission. Vielleicht hat hiermit zum ersten Mal in der Geschichte eine Befreiungsbewegung oder künftige Regierung eine unabhängige Untersuchung - in Form einer Wahrheitskommission - unterstützt, um den nicht nur gegen das frühere Regime, sondern auch gegen eigene Mitglieder erhobenen Vorwurf der Menschenrechtsverletzung untersuchen zu lassen. Nach einem langwierigen Verfahren, an dem alle Parteien der Regierung der Nationalen Einheit teilnahmen, stellte Justizminister Dullah Omar am 17. Mai 1995 im Parlament das »Gesetz zur Förderung der nationalen Einheit und Versöhnung« [Promotion of National Unity und Reconciliation Act] vor. Zur Begründung dieses Gesetzes sagte Dullah Omar: »Sein Inhalt betrifft den Kern der in der Verfassung verankerten Verpflichtung zur Versöhnung und zum Wiederaufbau der Gesellschaft. Sein Zweck besteht darin, jenes sichere Fundament aufzubauen, zu dem uns die Verfassung verpflichtet, damit das südafrikanische Volk die Spaltungen und Kämpfe der Vergangenheit überwinden kann, die zu schweren Menschenrechtsverletzungen geführt ... und ein Erbe des Hasses, der Angst, der Schuld- und Rachegefühle hinterlassen haben.« Am 19. Juli 1995 wurde das »Gesetz zur Förderung der nationalen Einheit und Versöhnung«, das die Wahrheits- und Versöhnungskommission ins Leben rief, von Präsident Nelson Mandela unterzeichnet und war damit rechtskräftig.
Ziele und Mandat der Kommission Das Hauptziel, das der Kommission vom »Gesetz zur Förderung der Nationalen Einheit und Versöhnung« vorgegeben wurde, bestand darin, »die nationale Einheit und Versöhnung in einem Geist des Verstehens zu fördern, der die Konflikte und Spaltungen der Vergangenheit zu überwinden hilft«. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden der Kommission vier Hauptaufgaben übertragen. Sie sollte - »ein möglichst umfassendes Bild von den Ursachen, der Art und dem Ausmaß« schwerer Menschenrechtsverletzungen erarbeiten, die zwischen dem l. März 1960 und dem 19. Mai 1994 stattgefunden hatten - einschließlich der Identifizierung von Einzelpersonen und Organisationen, die für solche Verbrechen verantwortlich waren, und der Aufdeckung ihrer Motive und Absichten; - dem Präsidenten Maßnahmen zur Verhinderung künftiger Menschenrechtsverletzungen empfehlen; - die menschliche und gesellschaftliche Würde der Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen wiederherstellen, und zwar durch Zeugenaussagen und - dem Präsidenten vorzulegende Wiedergutmachungsempfehlungen; - solchen Personen Amnestie gewähren, die relevante Fakten über politisch motivierte Straftaten lückenlos aufdeckten. Unter diesem Mandat hatte die Kommission auch Verbrechen zu untersuchen, die außerhalb des Landes begangen, aber in Südafrika geplant und vorbereitet worden waren. Als »schwere Menschenrechtsverletzungen« definierte das Gesetz »(a) die Ermordung, Entführung, Folter oder schwere Mißhandlung beliebiger Personen oder (b) jeden Versuch, eine der unter Paragraph (a) genannten Taten zu begehen, jede entsprechende Verschwörung, Anstiftung, jeden Befehl oder jede Veranlassung zu solchen Taten«, wenn dem Motive zugrunde lagen, die »auf den Konflikten der Vergangenheit beruhten, und die Straftat im Zeitraum vom 1. März 1960 bis zum 10. Mai 1994 innerhalb oder außerhalb der Republik begangen worden war und ihre Ausführung von einer politisch motivierten Person geplant, befohlen oder überwacht wurde«.
Vorwort von Erzbischof Desmond Tutu 1. Kapitel Eine Brücke zur Zukunft
Die Kommission
Juristische Probleme
Charakteristische Merkmale der Kommission
Die Amnestiedebatte
Die Debatte über den »gerechten Krieg«
Gerechtigkeit des Krieges
Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Gerechtigkeit im Krieg 2. Kapitel Die Wurzeln der Gewalt
Die Mandatsperiode: 1960-1994 3. Kapitel Hätte mein Körper einen Reißverschluß...
Morde an Aktivisten und MK-Mitgliedern
Hinterhalte
Opfer der Überwachung der öffentlichen Ordnung
Folteropfer
Todesfälle in Polizeigewahrsam
Gegenmobilmachung: Unterstützung von Ersatzgruppen
»Witdoeke«-Vigilanten im Western Cape 4. Kapitel Jenseits der Grenzen
Operation Reindeer: Die Angriffe auf die Lager
in Kassinga und Chetequera
Die »Brechstange«, die für Bargeld tötete:
Der Fall Koevoet
Überfälle durch Ersatztruppen
Überfälle jenseits der Grenzen
Geleugnete Operationen der »Todesschwadronen«
Entführungen und Morde
Ferngesteuerter Tod
Spezialoperationen kritischer Art:
Das Civil Co-operation Bureau 5. Kapitel Im Namen seines Herrn
Ciskei und Transkei
Die Pondoland-Revolte
Der Busboykott in der Ciskei
Morde an MK-Aktivisten
KwaZulu und Natal
Inkatha
Kriegsherren und Banden
Die Rolle der Sicherheitskräfte
»Operation Marion«
Der Krieg in den Natal Midlands
KwaNdebele und die Imbokodo-Vigilanten 6. Kapitel Im Namen des Kampfes
Der Afrikanische Nationalkongreß
Landminen-Kampagne
Morde an Einzelpersonen
Menschenrechtsverletzungen im Exil
Der Panafrikanische Kongreß
Vergehen der Poqo und Apia
Terrorakte im Exil
Die demokratische Massenbewegung
Konflikte zwischen verschiedenen Organisationen 7. Kapitel In der Morgendämmerung
Die Sicherheitskräfte während der neunziger Jahre
Mutmaßliche Beteiligung der Sicherheitskräfte an
politischer Gewalt
Heimliche Drahtzieher
Folter und die Politik der öffentlichen Ordnung
Gezielte Mordanschläge
Die Homelands in den neunziger Jahren
Politische Gewalt in KwaZulu und Natal
Siebentagekrieg
Attentate
Bildteil
Die KwaZulu-Polizei
Todesschwadronen
»Selbstschutzeinheiten«
Gewalt vor der Wahl
Der weiße rechte Flügel
Der ANC in den neunziger Jahren
Zusammenstöße mit der IFP in KwaZulu und Natal
Widerstand gegen das Homeland-System
Der Panafrikanische Kongreß 8. Kapitel Brennpunkte
Spezialanhörungen von Frauen
Spezialanhörungen über Kinder und Jugendliche
Exhumierungen
Der »Mandela United Football Club«
Südafrikas Pläne zur chemischen und biologischen Kriegsführung
Vernichtung von Dokumenten 9. Kapitel Versuche, zu verstehen
Entkolonialisierung und Antikolonialismus
Der Kalte Krieg
»Wir führten einen Krieg«
Gewaltspirale
Die Sprache des Krieges
Verleugnung
Fehler
Fehlende Disziplinarmaßnahmen
Jugend und geschlechtsspezifische Gewalt
Die Suche nach einer Perspektive
Rehabilitation der Täter 10. Kapitel Profit oder Verlust
Wirtschafts- und Gewerkschaftssektor
Die Bergbauindustrie
Landwirtschaft
Multinationale Konzerne
Die Justiz
Gesundheitswesen
Die Medien
Die Glaubensgemeinschaften 11. Kapitel Wiedergutmachung und Rehabilitation
Ein Versprechen an das Volk
Internationale Verträge und Wiedergutmachungen
Wiedergutmachung in Argentinien und Chile
Was bedeuten Wiedergutmachung und Rehabilitation?
Wiedergutmachungsempfänger
Wiederherstellung der Würde 12. Kapitel Nie wieder
Eine Reise, die noch nicht nicht zu Ende ist
Vergebung kann nicht eingefordert werden
Vergeben, nicht vergessen
Gemeinsame Humanität
Befreiung vom Haß
Zeit zur Wiedergutmachung
Erschütterte Überzeugungen
Die langen Greifarme des Konflikts
Versöhnende Kraft
Frieden zwischen Männern und Frauen
Und die Kinder leiden noch immer...
Schadensersatzleistungen
Respekt vor dem Leben
Nachwort von Dullah Omar, Justizminister von 1994 bis 1999
Nachwort zur deutschen Ausgabe von Theo Kneifel
Anhang l Unterwegs zur Zukunft
Strafverfolgung, Amnestie und Sühne
Wiedergutmachungsleistungen und Rehabilitation
Anhang 2 Amnestiekomitee
Status der Amnestieanträge
Zeittafel und Struktur der
Wahrheits- und Versöhnungskommission
Glossar und englische Abkürzungen
Südafrika von 1960 bis 1994 und Landkarte
Die Autorinnen, Autoren und Photographinnen |