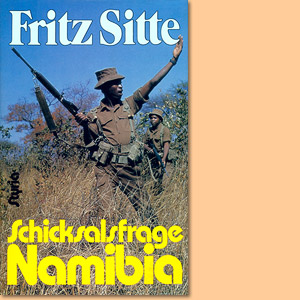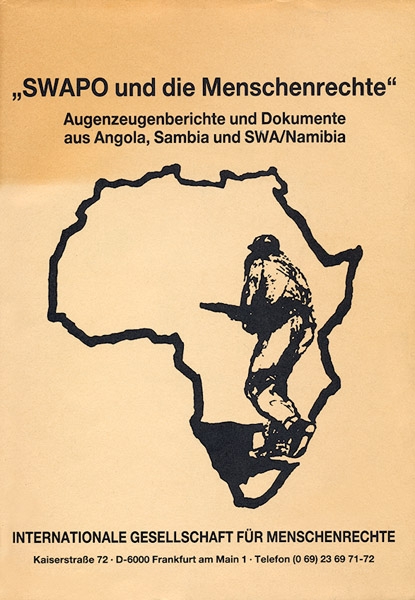Schicksalsfrage Namibia, Teil 2, von Fritz Sitte
Fritz Sitte beschreibt in seiner Reportage Schicksalsfrage Namibia, die Angst und das Grauen im Alltag im Norden Namibias: Beispiele für die Greueltaten der SWAPO gegenüber schwarzen und weißen Zivilisten.
Die Farmer sind daher dazu übergegangen, das Funknetz auszubauen, um sich so gegenseitig beistehen zu können und um die Polizei oder das Militär so schnell als möglich herbeizurufen. Viele Farmer haben ihre Häuser mit handgranatenabweisenden Gittern oder Stahlläden vor den Fenstern und Türen versehen, die nachts geschlossen werden. Außerdem findet man viele Farmhäuser bereits mit teilweise überhohen Drahtzäunen umgeben, und ein Rudel scharfer Hunde macht jede noch so behutsame Annäherung unmöglich. Während der Nacht tauchen grelle Scheinwerfer die Umgebung in taghelles Licht. Alles bekannte Bilder für Eingeweihte, wie man sie noch wenige Jahre zuvor in Angola und Rhodesien sehen konnte.
Der grauhaarige Farmer H. R.*) mit seinem ledergegerbten Gesicht meinte erbittert auf seiner Farm: »Vor einigen Monaten wachten wir um Mitternacht durch das Geschrei unserer Farmarbeiter und das Gebrüll unserer Rinder auf. Als wir dann alle zusammen mit Lampen zu der nahen Weide liefen, bot sich uns ein entsetzliches Bild. Mehr als zwanzig junge Rinder lagen brüllend vor Schmerzen am staubigen Boden und vermochten sich nicht mehr zu erheben. Die SWAPO-Leute hatten mit Macheten die Sehnen an den rückwärtigen Füßen der Tiere durchgehackt. Wir mußten die verwundeten Rinder alle noch in derselben Nacht notschlachten. Ganz abgesehen vom Schaden, den wir dadurch erlitten haben - den uns natürlich niemand ersetzt -, ist es für uns unbegreiflich, daß sich ein Mensch aus Haß zu solch bestialischen Brutalitäten hinreißen lassen kann.«
Das Farmerehepaar M. und W. B.*) hielt sich bei dem Gespräch an den Händen, als wollten sie damit verdeutlichen, daß sie niemand trennen könne: »Schon unsere Großeltern waren hier auf dieser Farm, und unsere Kinder wollen gleichfalls hier bleiben. Wir haben das Land urbar und bewohnbar gemacht - wir haben monatelang die Wasserbrunnen gegraben, all unsere Arbeit und Ersparnisse sind in diese Farm investiert. Wir kennen keinen Urlaub und auch weder Luxus noch Reichtum. Dürre und nun schon jahrelang die SWAPO mit ihren Überfällen - drei unserer schwarzen Ovambo-Farmarbeiter wurden bereits umgebracht - können uns von dieser Farm aber nicht vertreiben. Wir sind hier geboren und aufgewachsen, Afrika ist unsere Heimat. Selbst wenn wir dabei zugrunde gehen, aber wir werden unseren Boden bis zum letzten Atemzug verteidigen. Uns interessiert keine UNO und auch keine SWAPO, wir wollen in Frieden arbeiten wie unsere Vorfahren.«
Der deutschstämmige Farmer O. G. trägt Narben im Gesicht sowie an beiden Armen. Keine Miene zuckt, er sieht durch mich hindurch, als hätte er alle Gefühlsregungen längst über Bord geworfen, als er erzählt: »Vor einem halben Jahr habe ich meine Frau und mein einziges Kind verloren, eine zehnjährige Tochter, als beide mit dem Wagen zur Schule fahren wollten. Einen Kilometer von hier sieht man noch die Vertiefung in der Straße, wo die Mine explodierte. Als ich zur Stelle kam, sah ich nur mehr die zerfetzten blutigen Körper und den brennenden Wagen. Ich habe das Loch in der Straße so gelassen, weil ich täglich daran erinnert werden will, was damals passiert ist. Ich habe mir geschworen, daß ich bleiben und kämpfen werde. Diesen brutalen Mord wird mir die SWAPO bitter bezahlen - ich lebe nur mehr für diesen Gedanken -, sonst hätte das Leben für mich überhaupt keinen Sinn mehr. Vor zwei Monaten wurde die Farm von der SWAPO in der Abenddämmerung überfallen. Mit zwei Buschmännern, die ich auf der Farm angeheuert habe, verfolgte ich diese angeblichen Freiheitskämpfen zwei Tage lang, bis wir die fünf SWAPO-Leute an einem Lagerfeuer stellten. Ich schäme mich nicht zuzugeben, daß wir die Terroristen - für mich sind das keine anderen Elemente - niedergeschossen haben. Mag sein, daß sie mich eines Tages umbringen werden, das ist nicht so wichtig - ich war lange Jahre im Krieg und bin dreimal verwundet worden. Vielleicht aber werde ich diesen Krieg auch noch überleben.«
Das junge Farmerehepaar H. und G. M. hat fünf Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren. Die Eltern des jungen Farmers fuhren vor wenigen Monaten mit dem Auto auf eine Landmine und starben wenige Tage nachher im Krankenhaus. Vorsichtig, als würde er jedes Wort zuerst auf die Waage legen, bevor es über seine Lippen kam, erzählte er: »Ich bin von der Ausbildung her eigentlich Bankkaufmann, aber mein älterer Bruder kam bei einem Einsatz in Südangola - gegen die SWAPO - ums Leben. So blieb nichts anderes übrig, als nach dem Minentod meiner Eltern die Farm selbst zu übernehmen, denn verkaufen kann man solch einen Besitz im nördlichen SWA/Namibia kaum mehr. Ich habe mit meiner Frau immer wieder darüber gesprochen, was wir eigentlich tun sollten. Wir müssen ja an unsere Kinder denken. Wenn das alles so weiterläuft wie bisher, steht uns der große Krach möglicherweise noch bevor. Vielleicht werden uns die SWAPO-Leute nur verjagen, oder sie werden uns umbringen. Der ganze Besitz lohnt diesen Einsatz nicht. Unsere Rinderherden kann ich verkaufen, ich habe einen Beruf und kann meine Familie notfalls auch anderswo ernähren. Die Sicherheit und das Leben unserer Kinder gehen da vor, wenn uns auch der Abschied von unserer Farm mehr als nahegehen würde, denn wir hängen an diesem Boden und an dieser Farm. Ich verstehe nur den Westen mit seiner Politik nicht. Der Osten rückt näher und näher, und die Westmächte sehen tatenlos zu, indem sie eine Entspannungspolitik verfolgen und ein Stück nach dem anderen verlieren. Es wäre hoch an der Zeit, würde sich der Westen endlich besinnen und in derselben konsequenten Weise reagieren, wie es der Kreml praktiziert.«
Die beiden Brüder E. und F. J. sind »erst« 30 Jahre in SWA/Namibia und betreiben eine Rinderfarm. Sie reden meist gleichzeitig und sind deshalb schwer zu verstehen: »Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Bundesrepublik Deutschland nach Südwestafrika ausgewandert. Da unsere Gutshöfe in der DDR lagen und wir mit dem Familienschmuck das Startkapital für diese Farm noch in Händen hatten, blieb unser alter Wunschtraum als einzige Alternative offen: Farmer in Südwestafrika zu werden. Nach fünf Jahren fuhren unsere beiden Frauen mit den Kindern nach Deutschland zurück. Weil die Kinder in gute Schulen kommen müßten, erklärten beide übereinstimmend, als hätten wir hier in Windhoek nicht dieselben Schulmöglichkeiten. Es war aber nur eine Ausrede, denn zwei Jahre später ließen sich unsere Frauen scheiden. Zwei Hereromädchen führen seither für uns den Haushalt. In den beiden letzten Jahren verloren wir zwei Farmarbeiter durch Landminen, die genau bei unserem Farmeingang vergraben worden waren. Drei andere Ovambos auf unserer Farm wurden von SWAPO-Leuten in einer mondhellen Nacht aus ihren Hütten geholt. Man schnitt nicht nur ihnen, sondern auch ihren Familienangehörigen den Hals durch. Seither war es schwer für uns, Farmarbeiter zu bekommen. Wir mußten überhöhte Löhne zahlen, um das Risiko auszugleichen. Unseren Vormann nagelten sie mit einem Jagdmesser an die Lagerhaustüre. Wir waren damals gerade einige Tage in Windhoek, um geschäftliche Dinge zu regeln und Einkäufe zu machen. Den Schock werden wir wohl nie mehr vergessen können.«
Der Farmer W. H. L. ist fast 70 Jahre alt und blickt beiseite, wenn er mit jemandem spricht: »Meine Frau ist bereits in Holland, und ich warte nur mehr, bis ich meine restlichen Rinderherden möglichst günstig verkaufen kann. Ich habe mich das ganze Leben lang abgeschuftet und habe nicht die geringste Lust, mich hier noch von den Schwarzen abschlachten zu lassen. Die sind feige und hinterhältig, schleichen sich nachts an die Farmen heran und morden kaltblütig alles, was ihnen in den Weg läuft - auch ihre eigenen Stammesangehörigen. Sie wagen sich nur an die abseits wohnenden Farmer, aber Polizei- oder Militärstationen greifen sie nicht an, weil sie dort eine blutige Abfuhr erleiden. Wir haben uns an der Küste Hollands ein kleines Häuschen mit Blick zum offenen Meer gekauft, die Ersparnisse eines langen harten Farmerlebens. Ich habe genug von Südwest, das sich über kurz oder lang zerfleischen wird. Wir haben in Angola und Rhodesien deutlich genug vor Augen geführt bekommen, was uns auch hier erwartet. Die paar Jahre, die mir noch bleiben, will ich in Ruhe und Frieden erleben - deshalb gehe ich von hier fort -, ich bin sehr müde geworden.«
Der Farmer A. F. ist reichlich nervös und zwinkert immer mit seinen Augen, als wollte er einem Unbekannten ein Zeichen geben. Seine hagere Frau sitzt neben ihm und läßt kein Auge von seinem Mund, während er spricht: »Unsere Ovambos auf der Farm sind uns nach einem SWAPO-Überfall vor drei Monaten davongelaufen, oder die SWAPO-Leute haben sie mitgenommen. Für teures Geld mußten wir uns aus dem Süden ein paar Farmarbeiter als Ersatz anheuern. Ich behandle meine Leute gut und zahle auch keine schlechten Löhne. Vielleicht wäre die SWAPO - falls sie wirklich an die Macht käme - noch nicht der Weltuntergang. Sie würden uns ja auch nachher brauchen, und wenn man korrekt ist und keine Schuld auf sich geladen hat, bestünde vielleicht die Gelegenheit, sich irgendwie mit dieser SWAPO zu arrangieren!? Die Kommunisten in Angola haben zuerst auch alle Portugiesen verjagt, aber nachher kamen sehr viele wieder zurück, weil man sie brauchte, weil die Schwarzen allein ja doch nicht zurechtkommen. Wir haben noch eine zweite kleine Farm in Südafrika, wohin wir im Notfall ausweichen können, wenn hier wirklich alles schiefgehen sollte. Aber lieber würden wir in SWA/Namibia bleiben. Wir werden ja sehen, ob die Südafrikaner diesen Herrn Nujoma (Sam Nujoma ist der Führer der SWAPO) zu Recht verteufelt haben oder ob alles Propaganda war. Ich bin von Haus aus Optimist und werde so lange hier bleiben, als ich eine Chance sehe.«
Im Norden SWA/Namibias sind die Zivilisten - und da besonders die meist einsam und weit auseinander lebenden Farmer - die Leidtragenden. Krankenwagen, Fahrzeuge, die Kinder in die Schulen bringen, sowie Kraftfahrzeuge der Polizei und Armee sind sowohl gepanzert als auch minensicher. Während der Fahrt muß man nur fest angeschnallt sein, dann kann eine Minenexplosion zwar die Räder des Fahrzeuges wegreißen, aber die Insassen bleiben unverletzt. Alle Weißen in der Operationszone im Norden - ob Uniformierte oder Zivilisten - tragen stets Waffen bei sich.
Nicht alle Überfälle, Anschläge und Minenopfer werden in den Zeitungen oder im Rundfunk erwähnt, denn man will die Bevölkerung nicht noch mehr beunruhigen und verunsichern, lautet die Erklärung für die spärlichen Informationen. Ganz grob umrissen, kann man heute die Bevölkerung von SWA/Namibia in drei Kategorien einteilen:
- Menschen, die ihre Existenz bis zum letzten Blutstropfen verteidigen wollen und vielleicht auch werden, weil sie keine andere Heimat kennen.
- Menschen, die alles daransetzen wollen, um sich notfalls mit den neuen Machthabern - selbst wenn dies die SWAPO wäre - auf irgendeine Art zu arrangieren.
- Menschen, die bereits ihre Koffer gepackt haben oder in absehbarer Zeit noch packen wollen, um im richtigen Moment SWA/Namibia verlassen zu können. Viele haben es bereits getan.
Sicherlich sind die beängstigenden Zustände im Norden SWA/Namibias nicht spezifisch für die Hauptstadt Windhoek oder das übrige Land, aber die Entscheidung für die Sicherheit und Zukunft, gleichgültig, wie sie auch ausfallen wird, wird im Norden gefällt werden. […]
Zurück zu Teil 1 des Auszuges:Dies ist ein Auszug aus der Reportage: Schicksalsfrage Namibia, von Fritz Sitte
Buchtitel: Schicksalsfrage Namibia
Autor: Fritz Sitte
Verlag Styria
Graz; Wien; Köln 1983
ISBN 3-222-11462-5
Original-Leinenband, Original-Schutzumschlag, 14x21 cm, 235 Seiten , 14 sw-Fotos
Sitte, Fritz im Namibiana-Buchangebot
Schicksalsfrage Namibia
Die Schicksalsfrage Namibia war in den frühen 80er Jahren, unter dem Eindruck von Terror und Zukunftstangst, keine leere Phrase sondern eine alltägliche Sorge.
Weitere Buchempfehlungen
Wir aber suchten Gemeinschaft. Kirchwerdung und Kirchentrennung in Südwestafrika
Wir aber suchten Gemeinschaft ist die Geschichte der Kirchenspaltung und Kirchwerdung in Südwestafrika.
SWAPO und die Menschenrechte
SWAPO und die Menschenrechte dokumentiert die bekannt gewordenen Verbrechen der SWAPO während der 80er Jahre: Bedrohung, Verschleppung, Folter und Mord.