Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen, von Susanne Kuß
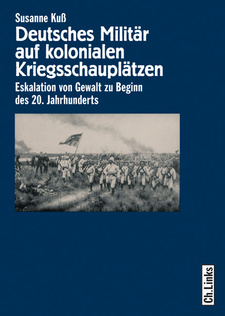
Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen, von Susanne Kuß. Studien zur Kolonialgeschichte: Christoph Links Verlag. Berlin, 2012. ISBN 9783861536031 / ISBN 978-3-86153-603-1
Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen: Mit dem Begriff des Kriegsschauplatzes grenzt die Autorin Susanne Kuß sich von bisherigen Erklärungsansätzen ab und versucht durch die Einflussfaktoren des jeweiligen Raumes, in dem die kriegerischen Auseinandersetzungen stattgefunden haben, die Eskalation der Gewalt zu erklären.
Kolonialkriege
Kolonialkriege zu definieren, scheint auf den ersten Blick einfach zu sein: Es sind Kriege, die in den Kolonien beziehungsweise in Übersee stattfinden. Das Kennzeichen »Übersee« berücksichtigt jedoch nicht die kontinentale Expansion etwa von Russland oder den USA. Nach der Zielsetzung unterscheidet man die Kolonialkriege in Eroberungskriege, Pazifizierungskriege, zwischenstaatliche Kriege in den Kolonien - wie der Spanisch-Amerikanische Krieg 1898, der Südafrikanische Krieg 1899-1902 und der Russisch-Japanische Krieg 1904/05 - oder Befreiungskriege im Rahmen des Dekolonisationsprozesses. Während der Eroberungskrieg den Anfangspunkt einer Kolonialherrschaft bezeichnet, steht der Befreiungskampf an deren Ende. Zur Zeit der Herrschaft aber dominieren Pazifizierungskriege. Die Kolonialeroberer kamen, um als Herrscher zu bleiben. Neben der permanenten Präsenz strebten sie die totale Unterwerfung der Bevölkerung und die euphemistisch als »Pazifizierung« bezeichnete Etablierung eines dauerhaften Friedens an. Hierbei handelte es sich um einen fortdauernden Prozess, der nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen war. Krieg und Frieden waren nicht deutlich voneinander getrennt. Infolge der Weite des Landes und der geringen Zahl von Verwaltungs- und Militärpersonal war der Kolonialstaat ein schwacher Staat, gekennzeichnet durch ein Gewaltdispositiv, das in Diskursen, Gesetzen - erinnert sei hier vor allem an das sogenannte väterliche Züchtigungsrecht -, administrativen Entscheidungen, Institutionen, wissenschaftlichen Arbeiten, in der Architektur, aber auch im Alltag zum Ausdruck kam. Kleinere militärische Aktionen wie das Verbrennen von Hütten oder die Beschlagnahme von Vieh galten als gewöhnliche Straf- oder Disziplinarmaßnahmen und waren an der Tagesordnung. Kaum eine Woche verging ohne solche Zwischenfälle. Die Zeitgenossen sprachen in diesem Fall nicht von »Krieg«, sondern von »Aktion«, »Aufstand«, »Expedition«, »Operation«, »Polizeioperation«, »Störung«, »Strafexpedition«, »Strafkampagne« und »Unruhe«. Mit dieser Palette an Begriffen waren stets lokal begrenzte Militärunternehmungen gegen widerständige Ethnien gemeint, die ohne allzu großen Aufwand überwältigt werden konnten. In einer Kolonialherrschaft wurde Gewalt täglich eingeübt und schließlich habituell ausgeübt. Aus diesen permanenten, aber begrenzten Low Intensity Conflicts entwickelte sich dann ein »Kolonialkrieg«, wenn sich die Auseinandersetzungen räumlich und personell ausdehnten oder über längere Zeit hinzogen. Dies gilt für den Herero- und Namakrieg in Deutsch-Südwestafrika 1904-07 ebenso wie für den Majimajikrieg in Deutsch-Ostafrika 1905/06. Der Boxerkrieg in China 1900/01 nahm insofern eine Sonderrolle ein, als es sich um eine internationale Strafaktion auf nicht erobertem Territorium handelte, während direkte Kolonialherrschaft nur in kleinen, verstreuten Enklaven an der Küste ausgeübt wurde. Abgesehen davon, dass Kolonialkriege als Pazifizierungskriege immer den Zweck verfolgten, die jeweilige Kolonialherrschaft aufrechtzuerhalten, unterschieden sie sich von den in Europa geführten Kriegen durch weitere sechs Merkmale:
Klein- oder Guerillakrieg
Der Guerillakrieg war ein asymmetrischer Krieg. Dies zeigte sich in der unterschiedlichen Bewaffnung von Kolonialherren und einheimischer Bevölkerung. Waren die Kolonialtruppen mit Maschinengewehren ausgerüstet, konnte letztere häufig nur auf veraltete Hinterlader oder gar auf schwerfällige Schlagwaffen zurückgreifen. Hinzu kam, dass die Guerillakämpfer ein defensives Kriegsziel verfolgten. Sie vermieden die offene Schlacht und konzentrierten ihre Angriffe auf Nachschubwege und feindliche Patrouillen. Ihre Vorteile lagen in ihrer Geschwindigkeit und Mobilität. Die Guerilla entwickelte keine ausdifferenzierte Logistik, sondern versorgte sich, teilweise gewaltsam, aus den Beständen der einheimischen Zivilisten. So wurden diese automatisch zu Semikombattanten, auch wenn sie sich am Krieg nicht aktiv beteiligten. Da eine Frontlinie nicht existierte, gingen Kampfzone, Etappe und besetztes Gebiet ineinander über.
(2) Die Kolonialkriege waren durch mangelnde Infrastruktur gekennzeichnet. Straßen oder Eisenbahnen existierten nicht oder waren allenfalls rudimentär vorhanden. Telegraphische Nachrichtenverbindungen bildeten die Ausnahme. Alle Planungen bezüglich Zeit und Raum erwiesen sich deshalb als problematisch. Auf eine einmal detachierte Abteilung konnte nicht mit Sicherheit gerechnet werden. Truppenoperationen hatten nur Aussicht auf Erfolg, solange Beförderungsmittel - Wagen, Zugtiere und Menschen - vorhanden waren. Menschen und Tiere mussten unterwegs versorgt werden. Die Organisation von Nachschub und Transport war daher mindestens ebenso wichtig wie die Vorbereitung auf die Kämpfe. Um die Sicherung der Versorgung zu gewährleisten, waren gegebenenfalls taktische Pläne kurzfristig zu ändern. [...]
Dies ist ein Auszug aus: Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen, von Susanne Kuß.
Titel: Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen
Untertitel: Eskalation von Gewalt zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Autorin: Susanne Kuß
Reihe: Studien zur Kolonialgeschichte
Verlag: Christoph Links Verlag
Berlin, 2012
ISBN 9783861536031 / ISBN 978-3-86153-603-1
Kartoneinband mit Schutzumschlag, 15 x 21 cm, 500 Seiten, 3 Karten
