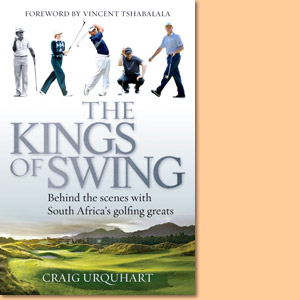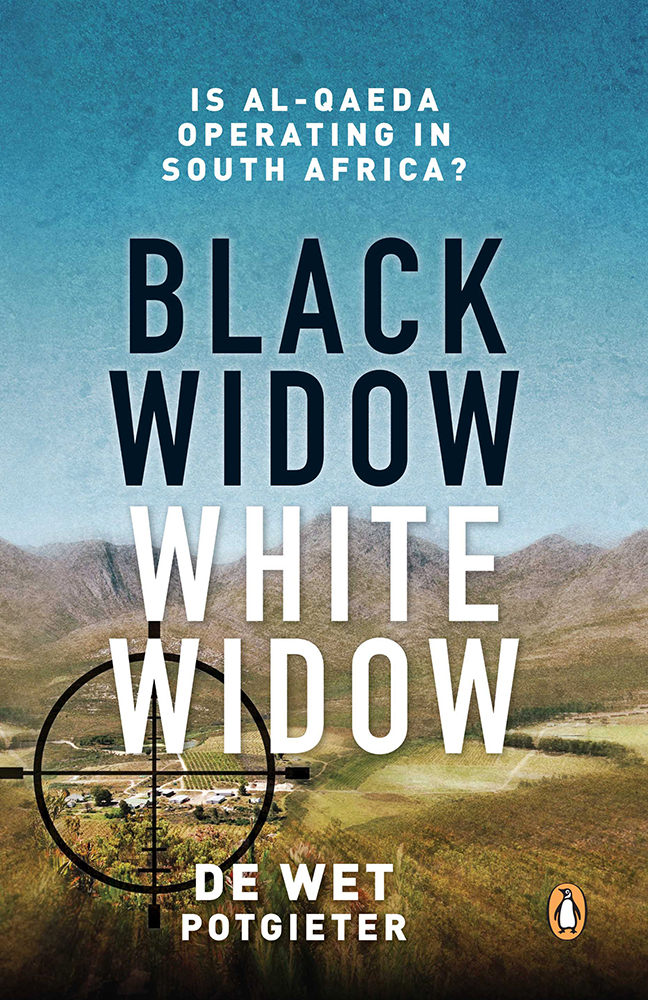Wille und Vorstellung. Reflexionen über eine Konferenz über die Ungleichheit in Südafrika. Von Andries du Toit

afrika süd, Ausgabe 6/2010. Besuchen Sie die issa! informationsstelle südliches afrika www.az.issa-bonn.org.
Südafrika ist eine extrem ungleiche Gesellschaft. Wissenschaftlern fehlt oft die Phantasie, über die üblichen Lösungsansätze hinauszudenken. Andries du Toit, Mitorganisator einer Konferenz zur Ungleichheit in Südafrika, fragt, ob wir uns eine andere Gesellschaft mit anderen Werten vorstellen können – ein Ansatz von zivilgesellschaftlicher Solidarität.
Der wohl provozierendste und anregendste Satz fiel eher beiläufig erst zum Ende der Bocksburg Inequalita Conference. Die Schlussrednerin Neva Makgetla erinnerte an Vorlesungen in Philosophie, die sie an einer Universität in der damaligen DDR besucht hatte. Es habe sie sehr beeindruckt, dass die ursprüngliche Motivation derer, die für eine sozialistische Gesellschaft gekämpft hatten und sie aufbauen wollten, die Vision war, dass der Sozialismus eine qualitative Veränderung der menschlichen Beziehungen bringen werde. Doch in der Praxis, auf dem Weg in die neue Gesellschaft, entschieden sie sich, materielle Fragen in den Mittelpunkt zu stellen. Geld, Sozialleistungen, Schulen. In Südafrika, sagte sie, habe sich ähnliches vollzogen. Der Kampf gegen Apartheid war verbunden mit dem Traum einer neuen Gesellschaft, die sich qualitativ deutlich unterscheiden würde von der fürchterlichen Spaltung der Gesellschaft durch die Apartheid. Doch das Land musste regiert, Programme entworfen werden. Und was letztlich übrig geblieben ist, seien BEE (Black Economic Empowerment) und Sozialhilfe.
Das war ein ernüchternder Kommentar. Aber er brachte mich auf den Gedanken, ob wir als Organisatoren der Konferenz unseren eigentlichen Gegenstand aus den Augen verloren hatten. Die Konferenz wurde veranstaltet, um die Ungleichheit in Südafrika in angemessenerer Weise auf die politische Tagesordnung zu bringen. All zu oft verlaufen Diskussionen über die Armut in Südafrika so, als sei Armut ein Nebenprodukt, als seien manche Leute irgendwie beim wirtschaftlichen Aufschwung abgehängt worden. Als ginge es lediglich darum, ihnen Hilfestellung und Möglichkeiten zu bieten, ihre Einkommen zu steigern, damit sie über die Armutsgrenze hinauskommen.
Diese kurzsichtigen Annahmen sollten auf der Konferenz angegangen werden. Die zentrale und drängendste Frage sollte nicht die Armut sein, sondern die Ungleichheit. Und dass in Südafrika Armut und Ungleichheit strukturell bedingt sind. Dass unsere Wirtschaft zwar Reichtum für wenige schafft, aber gleichzeitig eine Armuts-Maschinerie ist, die tief verwurzelte Ungleichheiten verstetigt und verschlimmert. Das gefährdet die Grundlagen sozialer Stabilität. Wir wollten auf dieser Konferenz das Scheinwerferlicht auf diesen Trend lenken und die Teilnehmer einladen, über Alternativen nachzudenken. Können wir uns eine andere Gesellschaft mit anderen Werten vorstellen? Wie soll so eine Gesellschaft aussehen? Diese Gedanken trieben mich um, als ich mich am ersten Morgen mit dem Organisationskomitee in einem italienischen Café traf, um den Fortlauf der Konferenz zu besprechen. Sie sollte eröffnet werden mit einer Video-Botschaft des stellvertretenden Staatspräsidenten Kgalema Motlanthe, der zu dem Zeitpunkt am ANC-Parteitag teilnahm. Dann sollte eine Lesung des Dichters und Performancekünstlers Flo folgen. Flo ist ein schüchterner, stämmiger Mann, immer mit einem Lächeln auf den Lippen. Wir fragten ihn, wie er seinen Auftritt plane und was er rezitieren werde. Wovon seine Gedichte handeln würden. Er dachte einen Augenblick nach und sagte: Oh! Soziale Fragen. Und Liebe. Einen Moment lang herrschte verlegenes Schweigen. Liebe? Nun, dachte ich, vielleicht ist es ja genau das, worüber wir reden sollten, über all unsere Beziehungen und die Welt, in der sie existieren.
Flos Gedichte waren aufrüttelnd, provozierend und entwaffnend zugleich. Sie trugen dazu bei, das Eis zu brechen und Gedanken in Gang zu setzen. Doch schon bald waren seine Worte vergessen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten sich voran und taten, was man auf einer Konferenz über Armut und Ungleichheit so macht: Lorentz-Kurven wurden erörtert, politische Systeme analysiert, Arbeitsbeschaffung und ländliche Entwicklung diskutiert. Wichtige Dinge, technische Dinge, die Fakten und Dynamiken, mit denen Macht und Ressourcen fließen. Und in dieser Hinsicht war die Konferenz gelungen. Erst Makgetlas Schlusswort machte deutlich, wie eine Betrachtung der Armut für sich, isoliert, zu einer verengten Sichtweise führt, bei der man sich ausschließlich auf bestimmte marginalisierte Gruppen fokussiert, während ein Fokus auf Ungleichheit grundsätzlichere Fragen nach gesellschaftlicher Transformation aufwirft.
Manche Beiträge durchleuchteten zwar verschiedene Aspekte der strukturellen Ungleichheit und es gab auch anregende Diskussionen über einzelne politische Maßnahmen und Instrumente. Doch am Ende, als ich Magketla zuhörte, wurde mir klar, dass auch wir, indem wir uns vornehmlich auf materielle, monetäre Aspekte von Armut und Ungleichheit konzentriert hatten, die Gelegenheit verpasst hatten, über die Qualität unserer gesellschaftlichen Beziehungen nachzudenken. Sicher, es gab gute Analysen zu Gender- und Machtfragen auf dem Arbeitsmarkt, über eine Entwicklungspolitik zu Gunsten der Armen. Doch die meisten Diskussionen drehten sich um materielle Ressourcen, um Institutionen, um Geld und Sozialleistungen. Zugestanden, es handelte sich um kein Treffen von Dichtern und Philosophen. Wir waren Sozialwissenschaftler, Regierungspolitiker, Entwicklungspraktiker und Gemeinde-Organisatoren und haben über Dinge geredet, die wir verstehen. Doch wo waren die schwerer greifbaren Fragen geblieben? Wie stellen wir uns eine Gesellschaft vor, die mehr auf einer moralischen, existenziellen oder ethischen Grundlage beruht? Ich schloss meinen Vortrag mit der Frage: Wie könnte der Ansatz aussehen für ein ganz anderes Projekt, jenseits von einem technischen Armutsmanagement oder blankem Populismus, ein Ansatz für zivilgesellschaftliche Solidarität? Hehre Worte. Doch wann beginnen wir, darüber nachzudenken, wie eine solche Politik gestaltet werden soll? Es ist nicht leicht, sich mit solchen Fragen zu befassen, ohne sich in Klischees und Schubladendenken zu verlieren.
Raum für Utopien
Deshalb dieses Essay. Mir geht es um die Utopie. Oder besser: Wie definiert man den Raum für utopisches Denken, das gleichzeitig Bodenhaftung in dieser Welt hat? Da taucht als erstes die Frage auf, mit welchen Mythen leben wir? Mit welchen Brillen sehen wir? Worin gründet unsere Wahrnehmung, wenn wir die Dinge betrachten; welche möglichen Träume lässt sie zu? Wenn wir über „Gleichheit“ nachdenken, über soziale Beziehungen, dann fällt es schwer, die spontan geäußerten Gedanken von vorfabrizierten Geschichten freizuhalten. Analysen monetärer Ungleichheiten sind nicht verkehrt. Die gefälligen Kurven über Verfügbarkeit von Ressourcen in einer ungleichen Gesellschaft verstellen jedoch häufig den Blick auf das, was scharfer Unterscheidung, präziser Einordnung, aber auch der feinen, folgenreichen Differenzierung bedarf: Die Differenz zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Herrn und Knecht, Boss und Abhängiger.
Das rein wirtschaftliche Konzept von Gleichheit – jeder hat das gleiche Einkommen – ist hilfreich als mathematische Hypothese, verfehlt aber den eigentlichen Punkt. Utopische Träume von Geschwisterschaft und Gleichheit sind lediglich Ersatzstücke, in sich geschlossene, irre führende Phantasien. Sie sind mehr von infantilen Sehnsüchten nach Dingen geprägt, die nicht real sind, statt von einer mutigen Einschätzung des Machbaren. Ganz zu schweigen von der typisch südafrikanischen Variante: Kommen die Rassenbeziehungen zur Sprache, schweifen die Gespräche schnell in sentimentale Phantasien über Versöhnung, Farbenblindheit, mögliche Projekte der Wiedergutmachung und in ein allgemeines Lamentieren darüber ab, wie schrecklich es doch ist, weiß zu sein. Das mag manchem Genugtuung bieten, doch hilft jenen nicht, die sehen müssen, wie sie über die Runden kommen, sich ums Notwendigste kümmern, die Kinder ernähren und ihr Auskommen bestreiten müssen in einer Welt, in der Differenzen und Widersprüche unaufhebbar, real und meinetwegen auch wertvoll sind. Was können wir uns vorstellen? Was können und sollten wir wollen? Ich fürchte, ich habe keine Antwort. Ich kann nur einige unzusammenhängende Markierungen anbieten, die mir vermutlich nicht mal den Weg weisen. Doch sie können zumindest helfen mir vorzustellen, wie die Landkarte und die Lage dieses Landes aussieht.
Bequem eingerichtet und erstarrt
Haben Sie also Nachsicht mit meinen mäandernden Gedanken. Ein guter Ausgangspunkt dafür liegt gleich vor der Haustür, genauer gesagt, im Rosmead Shopping Centre in der Rosmead Road, Kenilworth. Hier wurde die Akademikerin Gubela Mji, Leiterin des Zentrums für Rehabilitationsstudien an der Universität Stellenbosch, im September dieses Jahres brutal überfallen. Niemand weiß genau, was geschehen ist. Frau Mji wurde niedergestochen, erhielt schwere Schläge auf den Kopf und blieb mit einer Gehirnerschütterung, verwirrt und ohne Erinnerungen an den Überfall liegen. Ein Wachmann fand sie. Er hielt sie zuerst für eine Obdachlose, barfuß und blutend. Sie spuckte Blut und brauchte ambulante Behandlung. Er suchte Hilfe bei einer – wie es eine Zeitung distanziert nannte – national private health care chain, die ganz in der Nähe lag. Doch in den Augen der Rettungsmannschaft sah Frau Mji – barfuß, zerzaust, nicht bei Sinnen und schwarz – nicht aus wie jemand, der zahlen konnte. Für sie war sie eine Landstreicherin, und solche nahmen sie nicht. Es war der Wachmann, der durch sein hartnäckiges Insistieren schließlich eine Ambulanz fand, die sie mitnahm. Nach den ersten entrüsteten Schlagzeilen verloren die Zeitungen die Geschichte bald aus den Augen und berichteten nicht weiter von dem Fall.
Was lehrt uns dieser Fall? Er zeigt uns, wie groß die Kluft ist zwischen jenen von uns, die im Netz von Macht und Reichtum im Zentrum unserer Wirtschaft aufgefangen werden, und jenen auf der anderen Seite; und wie harsch die Konsequenzen sind. Er beleuchtet auch, wie fragil selbst Privilegien sind und wie leicht man draußen landet. Die Geschichte illustriert auch die erdrückende Realität rassischer Vorbehalte in diesem Land. Wäre Frau Mji weiß, man hätte sie nicht einfach auf der Straße liegen lassen, nur mit dem Sicherheitsmann als Schutz. Doch das Beschämendste und Perverse daran ist, dass der Fall nur eine Schlagzeile wert war, weil Frau Mji eine von „uns“, eine Mittelklasse-Frau ist. Mit ihr können wir uns identifizieren und bekommen bei dem Gedanken Gänsehaut, dass es auch uns selbst hätte treffen können. Darum die Schlagzeilen. Obdachlose werden jeden Tag angegriffen, Hilfe wird ihnen verweigert. Alltägliches hat keinen Nachrichtenwert.
So sieht die Post-Apartheidsgesellschaft aus, die wir geschaffen haben. Wir haben nicht nur eine der ungleichsten Gesellschaften auf der Erde; die Ungleichheit nimmt nicht nur zu, wir haben nicht nur durch ungleichen Zugang zu Macht und Privilegien die Gesellschaft zweigeteilt, in der die an den Rand Gedrückten praktisch keine Rechte haben – viel schlimmer, wir halten die Augen geschlossen und haben es uns mit erstarrten Gefühlen und Vorstellungen bequem eingerichtet. Diese Befindlichkeiten perpetuieren sich selbst, die Mauern werden immer höher gesetzt; die Gespenster der Selbstbereicherung und sinnlosen, demonstrativen Konsums gehen um.
Die Fähigkeit zur Identifikation
Der Überfall auf Gubela Mji ist ein schockierendes Verbrechen, das manche Aspekte unserer Gesellschaft illustriert. Der Fall sagt aber mehr. Frau Mji ist nicht nur das zufällige Subjekt einer Geschichte. Sie hat eine eigene Stimme. Und die hat sie in der Vergangenheit immer wieder laut und vernehmlich hören lassen, wenn sie auf die eigentlichen Fragen zu sprechen kam. In ihrem letzten Buch „Disability and homelessness: a personal journey of self-dicovery to the centre and back“ über Benachteiligte und sozialen Wandel legt sie eine klare und persönliche Abrechnung über den Ausschluss und die Marginalisierung von Obdachlosen vor. Sie hat deren Lebensbedingungen untersucht und sich dafür auf eine Selbstfindungsreise begeben. Sie lebte mit Obdachlosen in ihren Unterschlüpfen. Dabei sah sie sich mit ihrem eigenen Unbehagen über die Anwesenheit von Leuten konfrontiert, die sie gewöhnlich als „roh, gewalttätig und betrunken“ erlebt hatte. Die Reflexion darüber führte sie zum Kern der Probleme:
„Als ich die Lebensgeschichten der Leute hörte, ihre Probleme, Phantasien und Kämpfe, gingen in mir Veränderungen vor. Ich sah mich dem Drang ausgesetzt, ‚Diese Art von Person’ von der Person, die ich bin, zu unterscheiden. Gleichzeitig erkannte ich mich selbst in ihren Problemen, Phantasien und Kämpfen wieder... Ich war betroffen darüber, wie weit ich von meiner ländlichen Kindheit gereist war in die schwer verständliche Gewalt der Urbanität Kapstadts, eine gesellschaftliche Gewalt, die der abstrakten Gewalt meiner beruflichen Bildung mit ihren entsprechenden medizinisch wissenschaftlichen Kategorien, Begrifflichkeiten und Pathologien realen Ausdruck gab. In den Gesprächen mit anderen konnte ich eine Fähigkeit wiederentdecken, die mir durch Rationalisierung und Instrumentalisierung bei meiner medizinischen Ausbildung, ihrer Bürokratie und der Entfremdung durch einen urbanen Lebensstil schleichend abhanden gekommen war.“Die Aussagekraft der Geschichte von Mji liegt nicht nur darin, dass sie durch eine schreckliche Ironie des Schicksals die brutale Härte der abstrakten institutionellen Gewalt einer ungleichen Gesellschaft an ihrem eigenen Körper, ihre eigene Person erleben musste, es ist vor allem die Präzision, mit der sie den Finger auf ihre eigene Komplizenschaft mit der institutionellen Gewalt legt: Das Bedürfnis zu unterscheiden zwischen „dieser Art von Person“ und der eigenen. Man sollte es mit Leuchtfarben ans Union Building schreiben, auf jede Rand-Note. Das ist es, warum die Spaltungen in einer ungleichen Gesellschaft perpetuiert werden – die Unfähigkeit, sich mit anderen gemeinsam zu engagieren. Gleichzeitig hält Mji daran fest, dass das korrigiert werden kann. Wir können unsere Fähigkeit zur Identifizierung wieder gewinnen.
Ich finde diese Reflexionen hilfreich, wenn ich die Debatten und Dilemmata der Konferenz betrachte. Die Polarisierung und Verbindungslosigkeit zwischen zwei Denkrichtungen über Ungleichheit und was dagegen getan werden kann macht mich betroffen. Oberflächlich betrachtet handelt diese Trennung von der alten soziologischen Trennung von Struktur und Vermittlung. Auf der einen Seite stehen die Forscher und Analytiker, die die strukturelle Natur der Ungleichheit betonen: die Dominanz einer hoch konzentrierten und kapitalisierten Wirtschaft, welche die Grundlage für eine Wirtschaftspolitik zugunsten der Armen unterläuft. Auf der anderen Seite stehen die freiwilligen Praktiker, die auf Selbsthilfe setzen: Ihre Präsentationen kreisten darum, dass zur Lösung des Problems Optimismus und Glaube an die eigene Stärke seitens der Armen ausreichen, mit kleiner Unterstützung durch den Staat. Beide Sichtweisen haben ihre Vorteile und Wahrheiten. Aber sie bewegen sich in parallelen Universen, taub für die Argumente der jeweils anderen Seite und unfähig, den blinden Fleck in ihren Augen zu sehen.
Raum für zivilgesellschaftlichen Diskurs
Seeraj Mohammeds Präsentation über die Trends auf dem südafrikanischen Arbeitsmarkt waren ein gutes Beispiel für die erste Gruppe. Sein Vortrag über die verquere Entwicklung in Südafrikas Wirtschaft mit der ungebrochenen Dominanz des Bergbau- und des Energiesektors, das Versagen der Mittelklasse, in produktive Kapazitäten zu investieren, die Konzentration auf kreditfinanzierte Ausgaben und die desaströsen Folgen für den Arbeitsmarkt waren erhellend und zwingend. Was aber enttäuschte, war der entmutigende Tenor und die unbrauchbare Bedeutung der Analyse. Es gab nicht die geringste Andeutung auf eine politische Hebelkraft, wie der Trend hätte anders verlaufen können. Die Analyse zeigte eine gewisse Schicksalsgläubigkeit, ja Zynismus. Südafrikanische Unternehmer und Kapitalisten – so die Quintessenz – betreiben eigensüchtig Selbstbereicherung. Kann man anderes erwarten? Offensichtlich nicht. So laufen nun mal die Dinge im modernen Kapitalismus. Für eine Handlungsorientierung war diese Analyse wenig hilfreich.
Auf der anderen Seite des Spektrums stand eine Präsentation von Lebo Ramafoko über Kwanda, einem Projekt von Sun City, dem wohl beliebtesten TV-Programm. Charismatisch und anziehend, mit Enthusiasmus und zupackend demonstrierte Frau Ramafoko die Botschaft von Kwanda und Sun City: Emanzipation durch den Glauben an sich selbst und Medienaufmerksamkeit. Arme Gemeinden, die Zuschüsse für Arbeitsprogramme erhalten, werden zu einem nationalen Wettbewerb eingeladen. Kwanda erstellt über jede Gemeinde eine kurze Dokumentation, in der die Probleme und die heroischen Bemühungen der Ansässigen aufgezeigt werden. Bei Besuchen sechs Monate später werden die Fortschritte aufgenommen. Und dann werden die Fernsehzuschauer aufgefordert, ihre Meinungen zu äußern und für ihren Favoriten zu stimmen.
Es geht – mit anderen Worten – um gesellschaftliche Entwicklung durch gut gemachte Reality-TV. Der Streifen, der uns vorgeführt wurde, zeigte die Probleme der Gemeinde Peffertown am Stadtrand von Port Elizabeth. Niedergeschlagene Jugendliche mit Rastafrisuren erzählten schreckliche Geschichten mehr zufällig erfolgter Gewalttaten. Die Heldin, eine gewisse Denis, suchte die Gemeinde einander näher zubringen. Die stämmige und kompromisslose junge Frau mit hübschem Gesicht und glasklarem Blick spielte im Rugby-Klub. Ihre Gemeindearbeit verfolgte sie mit dem gleichen Engagement und der gleichen Leidenschaft wie auf dem Spielfeld. Jeder kann zumindest für eine Viertelstunde ein Held sein – als Gemeindeaktivist.
Doch ist das realistisch? Lebo Ramafokos Enthusiasmus verführte einen zu glauben, hier werde der Weg aus der Ungleichheit gewiesen. Sie nutzte das Medium, um eine virtuelle Gemeinschaft zu formen, gegründet auf Optimismus und Selbsthilfe. Doch virtuelle Gemeinschaften lösen sich wieder auf, und Gemeindeprogramme können bestenfalls die extremen Auswüchse von Vernachlässigung mildern. Wenn die Wirtschaft keine Jobs schafft, was kann Kwanda mehr sein als ein Hype?
Und doch würde etwas fehlen, wenn Kwanda von den Bildschirmen verschwände. Da helfen uns die Überlegungen von Frau Mji weiter, auf Werte zu achten, die wir vermissen. Mji bleibt nicht beim verlorenen Gemeinschaftsgefühl hängen, bei der abstrakten Gewalt und der Verweigerung von Solidarität, die als gegeben hingenommen werden. Sie erinnert uns daran, dass diese Fähigkeit in uns steckt. Sie verbindet diese Fähigkeit eng mit ihren kulturellen Wurzeln als afrikanische Frau vom Lande. Doch sie steckt in uns allen: Die Fähigkeit und auch Bereitwilligkeit, sich im anderen zu erkennen.
Kwanda zeigt, dass unter der Oberfläche immer noch unsere utopische Vorstellung vom Guten, von Mitgefühl und Solidarität lebt. Zugleich zeigt das TV-Projekt einen Weg, diese Energien zu mobilisieren. Doch in Projektionen steckt immer auch Illusion. Sie können aber auch eine heilsame Desillusionierung auslösen, einen Prozess von Entdeckung und Wandel. Bei aller Naivität und schierem Optimismus bringt Kwanda etwas, was linken Kritikern der herrschenden Strukturen oft abgeht: Es konstruiert eine subjektive Position, von der aus Aktionen möglich sind.
Bei allen Einschränkungen zeigt Kwanda Möglichkeiten eines Weges nach vorn auf. Das erinnert an die Fußballweltmeisterschaft, wo für einige Wochen der Traum, die Welt willkommen zu heißen, uns Südafrika so sehen ließ, wie wir es gern sehen wollen. Eine Demonstration auch gegen die schwer belasteten Beziehungen zum Norden, der Wunsch, von der Welt wahrgenommen zu werden. Es war eine narzisstische Sicht im engen Sinne des Wortes, ein Wunsch, von maßgeblichen Anderen anerkannt zu werden. In dem Augenblick, in dem wir nicht mehr auf den Bildschirmen erschienen, zerfiel auch unser Bild im Zerrspiegel der Weltöffentlichkeit. Die Wärme dieser Wochen war dahin. Meine Fragestellung dreht sich um den Raum, den Südafrika für einen Diskurs zivilgesellschaftlicher Solidarität öffnet. Können wir uns selbst definieren, ohne nach Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit zu schielen? Können wir einen Weg zur Begegnung mit uns selbst finden, „vor unserer Tür und unserem eigenen Spiegel“? Können wir letztlich handeln als „Wir“, jenseits der Antagonismen, der belastenden Erinnerungen? Können wir uns das vorstellen?
Andries du Toit leitet das Institute for Poverty, Land and Agrarian Studies (PLAAS). Aus: Pambazuka News 503, 4.11.1010
Mit freundlicher Genehmigung der informationsstelle südliches afrika e.V. issa, veröffentlicht das Namibiana Buchdepot den Beitrag von Andries du Toit: Wille und Vorstellung. Reflexionen über eine Konferenz über die Ungleichheit in Südafrika.
Empfehlungen
Kinderarmut als Herausforderung für sozial-anthropologische Bildungskonzepte. Fallbasierte Forschungsstudien im Vergleich Deutschland-Namibia
Neuartige und fallbasierte Forschungsstudie, die Kinderarmut im Vergleich von Deutschland zu Namibia untersucht und sozial-anthropologische Bildungskonzepte anregt.
The Kings of Swing. Behind the scenes with South Africa's golfing greats
The Kings of Swing is the intimate and extraordinary story of those South Africa's golfing greats who have won numerous major championships.
Black Widow White Widow: Is Al-Qaeda operating in South Africa?
Black Widow White Widow: Is Al-Qaeda operating in South Africa? shows how terror factions launch attacks in other African countries.
Towards Shared Research
Towards Shared Research: Participatory and Integrative Approaches in Researching African Environments.
Turnschuhdiplomatie
Turnschuhdiplomatie: Die internationalen sportpolitischen Beziehungen der DDR nach Afrika als besonderer Bestandteil ihrer Außenpolitik (1955-1990).