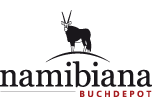Autor: Deon Meyer
Übersetzung: Ulrich Hoffmann
Verlag: Rütten & Loening
Berlin, 2008
ISBN: 978-3-352-00759-0
Kartoneinband mit Schutzumschlag, 14x22 cm, 421 Seiten
Er nennt sich Lemmer, er ist weiß, und sein Job ist es, unsichtbar zu sein, der Bodyguard im Schatten. Als Emma le Roux, eine weiße Südafrikanerin, ihn anheuert, hofft Lemmer auf einen schnellen, harmlosen Job.
Er soll Emma zum Krüger Nationalpark begleiten. Sie meint, ihren vor zwanzig Jahre verschwundenen Bruder in den Fernsehnachrichten gesehen zu haben. Angeblich hat er skrupellos vier Wilderer getötet, die ein Reservat überfielen.
Kaum sind sie im Krüger-Park angekommen, muss Lemmer eine giftige Schlange töten, die jemand in Emmas Apartment geschmuggelt hat. Er beginnt zu begreifen, dass er einer Sache auf der Spur ist, die etliche Nummern zu groß und zu gefährlich für ihn ist. Dann, nach ihrer ersten Liebesnacht wird Emma schwer verletzt. Allein versucht Lemmer ihren Angreifer zu finden.
Deon Meyer, Jahrgang 1958, gilt als einer der erfolgreichsten Krimiautoren Südafrikas. Er begann als Journalist zu schreiben und veröffentlichte 1994 seinen ersten Roman. "Das Herz des Jäger" wurde mit dem ATKV Prose Prize ausgezeichnet, einem begehrten südafrikanischen Literaturpreis. In den USA wurde der Roman zu den zehn besten Thrillern des Jahres ernannt.
Die Zeit, Tobias Gohlis:
Selten ist es einem Autor so elegant und authentisch gelungen, eine plausible Thrillerhandlung aus realen Konflikten zu entwickeln. Deon Meyer ist ein überragend spannender Chronist einer schuldbeladenen Gesellschaft im Aufbruch.
Die Welt, Krimi-Bestenliste:
Eine abenteuerliche Geschichte durch Südafrikas Wildnis, Gesellschaft und Geschichte. Großartig, epischer Atem. Meyer wird immer besser.
Frankfurter Rundschau, Sylvia Staude:
Meyer versteht es, einen gierig Seite um Seite umblättern zu lassen. Keine Zeile dieses Buches ist lau, und so kann es auch den Leser kaum kalt lassen.
Arte:
"Weißer Schatten" ist Meyers bisher bester Roman. Ihm gelingt es auf faszinierende Weise, einer Reihe von gärenden Problemen des jungen demokratischen Südafrika in lebendigen Figuren Gestalt zu geben.
Hamburger Abendblatt:
Deon Meyer ist ein hochkarätiger Spezialist für spannende sozialkritische Kriminalromane. ... Ein starker, mitreißender Thriller, in dem einfach alles stimmt.
Kulturnews:
Deon Meyer gelingt es auch mit diesem Roman, Südafrika mit all seinen politischen und gesellschaftlichen Problemen darzustellen - und zugleich eine spannende Geschichte zu erzählen. Einer der besten Thriller der Saison!
Hamburger Abendblatt, Peter Münder:
Deon Meyer ist ein hochkarätiger Spezialist für spannende sozialkritische Kriminalromane wie "Weißer Schatten", in dem er die gesellschaftspolitische Umbruchphase Südafrikas thematisiert. ... Ein starker, mitreißender Thriller, in dem einfach alles stimmt.
Adrenalin schaltet die Welt auf Zeitlupe. Die Motorhaube des BMWs sackte einen Augenblick herunter, als der Reifen platzte. Ich kämpfte mit dem Steuerrad, der Wagen reagierte nicht wie erwartet, ich wollte zurückschauen, wo waren die beiden aus dem Nissan?
Ich trat wieder aufs Gas, der Hinterradantrieb griff, der Wagen blieb einen Moment in der Kurvenlinie, aber ich fuhr zu schnell, und die Traktion vorn reichte nicht mehr. Das Hinterteil brach aus und schleuderte über die R40 in Richtung des Kiesbettes am Rande. Ich kämpfte darum, es unter Kontrolle zu bekommen.
»Lemmer!«
Die Reifen quietschten, der BMW drehte sich um hundertachtzig Grad, die Schnauze zeigte jetzt zurück in Richtung der T-Kreuzung. Die zwei aus dem Nissan kamen auf uns zu, Balaclava-Köpfe, schwere Waffen. Handschuhe?
Ich versuchte den Wagen zu wenden.
Etwas knallte gegen den Wagen. Donk.
Am Rande meines Blickfeldes blitzte etwas auf dem Feld. Sonnenlicht auf einem Gewehrlauf? Ich kurbelte am Steuerrad, die Hände nass vor Schweiß, drückte aufs Gas.
Donk – noch ein Reifen, rechts hinten, war kaputt. Der BWM kurvte und schaukelte, setzte sich gerade noch in Bewegung.
»Lemmer!«
»Ruhe bewahren!« Ich wendete und beschleunigte, die Motorhaube drehte sich, weg von den Sturmhauben, sie zeigte nach Norden, dorthin mussten wir. Ein Wagen näherte sich uns, hupte verzweifelt, wich gerade noch rechtzeitig aus. Ein ängstliches Gesicht huschte vorbei. Ich trat wieder aufs Gas, der Reifen hinten löste sich endgültig. Metall kreischte auf Teer, ein Jaulen. Wir zuckten nach vorn, weg von ihnen, dreißig, vierzig, fünfzig Meter. Es quietschte und ruckte, aber der Wagen behielt immerhin Kurs in der Mitte der Straße. Wir beschleunigten, in der Ferne kamen Autos näher.
Dann schossen sie einen weiteren Reifen kaputt, links hinten. Jetzt war der BMW nicht mehr zu kontrollieren. Ich musste langsamer werden – oder wir mussten raus. Langsamer werden war keine gute Idee. Ich konnte sie im Rückspiegel hinter uns her rennen sehen. Ziel aufs Feld, fahr ins lange Gras, weiter weg, so weit wie möglich! Eine letzte Beschleunigung, achtzig, neunzig Meter, Rand, Kies, Gras …
Der Wagen durchschlug den Zaun, Drähte schnappten mit einem Surren zur Seite. Ich bremste brutal, eine letzte Kurve, seitlich ins Gras, der Motor soff ab. Plötzlich war es still.
»Raus!«
Emma öffnete ihre Tür, kam aber nicht raus. Ich löste meinen Sicherheitsgurt und wandte mich in ihre Richtung.
»Der Gurt ist noch geschlossen.« Ich achtete darauf, dass meine Stimme ruhig blieb, während ich ihren Sitzgurt löste.
»Raus. Sofort!« Ich öffnete meine Tür und sprang heraus, sie war schon draußen, ich packte sie bei der Hand und zerrte sie hinter mir her.
»Moment«, kreischte sie, Angst im Gesicht, aber sie wandte sich um und tauchte noch einmal in den Wagen. Sie packte ihre Handtasche und griff nach meiner Hand.
Ein Zug pfiff. Nordwestlich von uns. Ich zog Emma mit, und wir rannten.
»Kopf runter«, rief ich. Das Gras war hier nicht so hoch wie am Straßenrand. Mopani-Bäume und Dornenbüsche verdeckten uns. Ein Schuss knallte hinter uns. Eine Pistole. Die Kugel sauste rechts an uns vorbei.
Der Scharfschütze mit dem Gewehr, der mit großem Geschick unsere Reifen zerschossen hatte, war irgendwo im Westen, im Südwesten, ich konnte ihn nicht sehen. Zwei Balaclavas hinter uns. Drei insgesamt?
Handschuhe? In dieser Hitze?
Noch zwei Schüsse. Ziellos. Sie wussten nicht genau, wo wir waren.
Das Rumpeln des Zuges, jetzt direkt nördlich. Die Gleise waren irgendwo vor uns. Aber wo? Ich konnte sie nicht sehen. Ich beschleunigte, zerrte Emma hinter mir her. Ameisenbärloch. Ich sprang. Emma stürzte, und ihre Hand glitt aus meiner.
Ich wirbelte herum, sie lag ausgestreckt da. Mit den Händen hatte sie versucht, den Fall abzufedern, ihr Kopf war gegen irgendetwas geschlagen, einen Stein oder einen Baumstumpf. Emma blutete, eine zwei Zentimeter lange Wunde an der Wange, neben dem Auge. Ich zog sie hoch.
»Weiter«, sagte ich. Ihr Blick war benommen. Ich schaute zurück. Unsere Verfolger liefen durch das Gras und die Büsche, rannten auf uns zu.
»Lemmer …«
Ich zog sie bei der Hand. »Wir müssen laufen.«
»Ich habe …«, Emma hob die Hand an die Rippen, atemlos, … mich verletzt.«
»Später! Wir müssen weiter.«
Ihr Mund stand offen, sie atmete keuchend, ihre Wange blutete, wir waren zu langsam.
Der Zug.
Der Lärm erfüllte unsere Ohren, er war nah, ich konnte ihn sehen. Eine Diesellokomotive, ein Güterzug, ein donnernder brauner Tausendfüßler. Zu schnell, er fuhr zu schnell. Zwischen uns und der Betriebsstraße der Bahn ein Stacheldraht, dann ging es noch einen Meter das Kiesbett hoch bis zu den Gleisen.
Ich zerrte Emma dorthin. Wir hatten keine Zeit, über den Zaun zu klettern. Ich packte sie, beide Hände um ihre Brust.
»Nein«, schrie sie. Sie keuchte wegen ihrer schmerzenden Rippen. Ich hievte sie über den Stacheldraht, und sie stürzte auf die andere Seite. Ich rannte, sprang drei Meter weiter darüber. Emma versuchte aufzustehen. Ich schaute zurück. Die Männer kamen. Siebzig Meter. Oder sechzig. Zwei. Sie hielten an. Winkten jemand zu. Dann sah ich ihn, direkt im Süden. Der Mann mit dem Gewehr. Ein großer Mann, weiß, in Tarnklamotten, mit Baseballkappe. Er ließ sich zu Boden fallen. Die Balaclava-Männer schauten wieder zu uns und begannen zu laufen.
Ich erreichte Emma, sie krümmte sich. Ihre Lippen formten »Lemmer«, aber der Zug übertönte jeden Laut. Sie sah schlimm aus, Blut auf der Wange, am Hals, der Schnitt war tief, aber ihre Hand lag auf ihren Rippen.
Keine Zeit.
Ich rief: »Das wird jetzt weh tun.« Ich schob meine linke Hand in ihren Rücken, packte sie fest und lief das Kiesbett hoch. Ihre Handtasche blieb im Gras zurück. Egal, wir rannten neben dem Zug entlang. Er war zu schnell, aber unsere einzige Chance. Ich streckte meine rechte Hand aus, wartete auf den nächsten Waggon. Ich packte zu, und das Metall schlug gegen meine Hand. Schmerz. Ich rannte, wartete auf den nächsten. Packte wieder eine Metallstange.
Der Waggon riss uns mit. Ich klammerte mich an Emma, schwang sie hoch. Zu viel Gewicht in meinen Armen. Sehnen und Muskeln kreischten, hoch zwischen die Waggons. Wir trafen auf Metall, mein Kopf schlug gegen die Seite, Schwindel, ich hielt Emma fest. Meine Füße tasteten nach Halt, nach Gleichgewicht. Ich zog sie zu mir, hielt sie dicht an mir, ihre Hände packten meine Schultern. Sie schrie etwas, das ich nicht hören konnte.
Wir würden es schaffen.
Ich schaute aufs Feld. Die Balaclavas standen still.
Der Scharfschütze lag auf dem Bauch, die Waffe vor sich, Stativ, Teleskop eigenartig, ungewöhnlich, anders. Der Gewehrlauf folgte der Bewegung des Zugs, folgte uns.
Ein Rauchwölkchen aus der Waffe. Dann war er verschwunden, aus meinem Blickfeld, aber Emma zuckte in meinen Armen und stürzte. Sie kippte weg von mir. Ich packte zu, erwischte den dünnen Stoff ihres T-Shirts mit den Fingern. Ich hielt daran fest, ein Strohhalm.
Es begann zu reißen. Ich sah das Blut oben auf ihrer Brust, die Austrittswunde. Er hatte Emma getroffen. Wut explodierte in mir. Der Stoff zerfetzte, sie fiel in Zeitlupe, mit geschlossenen Augen, eine Lumpenpuppe. Dann war sie weg, nur ein Stückchen T-Shirt blieb in meiner Hand.
Ich sprang vom Zug. Zu lange in der Luft, Stein und Gras huschten vorüber. Ich traf auf den Boden, meine Schulter schlug auf, ein Hammerschlag des Schmerzes. Ich war atemlos. Ich rollte herum. Etwas stach mich. Scharf und plötzlich. Ich rollte, trat nach etwas, rollte, rollte. Hielt. Ich konnte nicht hoch. Keine Luft. Ich musste Emma finden. Meine Schulter musste ausgerenkt sein, mit dem rechten Arm war etwas nicht in Ordnung, vor und neben mir Schmerz. Ich konnte nicht atmen, versuchte aufzustehen, keuchte, zwang Luft in meine Lungen, Schulterschmerzen. Ich keuchte wie ein Bulle, musste atmen. Ich taumelte, lief und fiel. Richtete mich auf. Da lag sie.
Totenstill.
»Emma« – aber das Wort kam nicht heraus, nicht genug Luft.
Sie lag auf dem Gesicht. Blut an ihrem Kopf.
Hinten. Zu viel Blut. Blut auf ihrem Rücken. Da war die Einschusswunde. Ich drehte sie mit der linken Hand herum. Sie war nicht bei Bewusstsein, ihr Körper schlaff. O Gott, bitte, ich presste meine Brust an ihre, schob meine linke Hand hinter ihren Rücken, drückte sie an mich, stand auf. Sie hing über meiner Schulter, leblos. Atmete sie?
Der Zug war weg.
Die Sturmhauben kamen.
Ich musste rennen. Trug Emma.
Taumelte. Wie sollte ich über den Zaun gelangen? Ich rannte auf die andere Seite der Gleise, weg von ihnen. Ich musste über den Zaun. Konnte nicht.
Da war ein Tor. Wie ein Hochtor. Die Einfahrt zur Betriebsstraße. Da mussten wir rüber. Ich musste das Tor herunterdrücken, mich darüber schwingen und springen. Ich rannte, stolperte, taumelte. Ich musste meinen rechten Arm benutzen, aber würde er halten? Ich drückte meinen rechten Arm auf das Tor, schwang meine Beine und Emma hinüber. Es war ein unwirklicher Augenblick in der Luft, der Arm würde das nicht schaffen. Er gab nach, entsetzlicher Schmerz, meine rechte Hüfte traf die Oberseite des Tors. Wir rollten hinüber, auf meinen Rücken, Emma obenauf, Gott sei Dank. Ich musste aufstehen, Emma wurde immer schwerer. Ich schaffte es auf die Knie, meine linke Hand war glitschig vom Blut von Emmas Rücken.
Ich war auf den Beinen. Sie zitterten.
Lauf! Bäume. Da waren Bäume, die Baumlinie in zwanzig Meter Entfernung, das Rumpeln des Zuges verklang.
Ich hörte sie hinter mir rufen. Wir mussten die Bäume erreichen. Meine Knie klagten, meine Schulter war zum Teufel, der Schmerz war eine Welle, die sich zu überschlagen drohte. Du musst leben, Emma le Roux, du musst leben.
Zwischen die Bäume. Ein Fußweg, ein Wildwechsel. Ich lief, taumelte, durch die Mopanis vor mir. Folge nicht dem Weg – das werden sie tun. Ich bog ab, nach rechts. Ich konnte Rauch riechen, brennendes Holz. Waren Menschen in der Nähe?
Schau, wo du hintrittst, mach keinen Laut, lauf tiefer in den Busch. Ich hatte keinen Atem mehr, meine Brust stand in Flammen, die Beine taub, die Schulter ausgerenkt. Die Bäume öffneten sich, und dort waren Hütten, ein einfaches Fleckchen, fünf Frauen um ein Feuer. Drei Kinder spielten im Staub, eines war auf den Rücken einer Frau gebunden.
Kochtöpfe. Die Frauen beugten sich über die Töpfe. Sie hörten mich und schauten mit weit aufgerissenen Augen auf. Sie sahen einen verrückten Weißen mit einer blutenden Frau auf der Schulter. Ich hörte die Balaclavas hinter mir rufen. Zu nah. Wir würden es nicht schaffen.
Ich rannte auf die mittlere Hütte zu. Die Tür war angelehnt, ich lief hinein, stieß die Tür mit der Hüfte zu. Zwei Matratzen am Boden. Ein kleiner Tisch mit einem Radio darauf. Ich legte Emma hin und schaute zur Tür. Wenn der Erste hereinkam, würde ich ihm die Waffe entreißen müssen. Mit einer Hand? Nicht zu schaffen. Meine einzige Chance.
Ich versuchte zu lauschen. Es war totenstill. Es gab einen Spalt neben der Tür, ich spähte hindurch. Sie kamen aus dem Busch, ebenso überrascht von den Hütten, blieben stehen, sahen die Frauen, schwangen die Pistolen.
Sagten etwas in einer Stammessprache. Keine Antwort. Ich konnte die Frauen am Feuer nicht sehen. Eine Sturmhaube rief etwas, bedrohlich und streng. Eine Frauenstimme antwortete ihm mit Angst in der Stimme. Sie starrten sie einen Augenblick an, dann liefen sie davon. Weg, aus meinem Blickfeld.
Ich lauschte. Ein Kind schrie. Dann ein zweites. Frauenstimmen beruhigten sie.
Hatten die Frauen sie in die Irre geschickt?
Ich ging hinüber zur Matratze. Emma lag zu still da. Ich legte mein Ohr an ihren Mund. Sie atmete unregelmäßig. Nicht gut. Zu viel Blut auf ihrer Brust. In ihrem Haar, auf ihrem Hals, ihrer Wange. Ich musste sie ins Krankenhaus bringen. Sofort.
Die Tür öffnete sich. Eine Frau stand unsicher da.
»Is hulle weg?«, fragte ich.
Keine Reaktion.
»Sind sie weg?«
Sie sagte etwas, was ich nicht verstand. Sie sah Emma an.
»Doktor«, sagte ich.
»Doktor«, wiederholte sie und nickte.
»Schnell.«
Wieder ein Nicken. »Schnell.«
Sie wandte sich um und rief drängend nach jemand.
Die Welle brach.