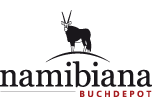Originalausgabe: O Sétimo Juramento
Autorin: Paulina Chiziane
Übersetzung: Michael Kegler
Verlag: Brandes & Apsel
Frankfurt, 2003
Kartoneinband, 14x21 cm, 240 Seiten, Karten
David, der korrupte und scheinbar allmächtige Leiter eines maroden Staatsbetriebes, ausgestattet mit allen Insignien des modernen, urbanen Erfolgsmenschen, einer gut aussehenden Frau und zwei wohlgeratenen Kindern, sieht sich plötzlich bedroht. Die Arbeiter streiken, seine Machenschaften fliegen auf und in der Firmenleitung wird offen an seinem Stuhl gesägt. Einige Niederlagen später findet sich David in einer magischen Session wieder. Die Macht der Geisterwelt, die er in seiner Zeit als Revolutionär noch bekämpft und verachtet hatte, soll nun sein Leben und seinen Reichtum retten. Im Strudel dieser mächtigen Allianz mit dem anderen Gesicht der Welt ist David bereit, über Leichen zu gehen. Jede Moral, jede menschliche Regung, seine Beziehungen, selbst das Leben seiner Angehörigen opfert er seinem Wahn und der Gier nach Profit. Das siebte Gelöbnis seines Lebens ist der Pakt mit dem Bösen. Verzweifelt sucht schließlich auch Davids Frau Hilfe bei traditionellen Heilern und Sehern, und es kommt zum titanischen Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und den Kräften des Guten. Chiziane, Paulina: Geboren 1955 in Manjacaze in der Provinz Gaza, zog mit sechs Jahren mit ihren Eltern in der Hauptstadt Lourenco Marques (heute: Maputo). Besuch der Handelsschule, Sekretärin; Linguistikstudium an der Universität Maputo; arbeitete beim mosambikanischen Roten Kreuz. Neben Kurzgeschichten Veröffentlichungen der Romane Balada de Amor ao Vento (1990) und Ventos do Apocalipse (1993).
Die Illusion eines besseren Morgen ist längst schon verwelkt, deshalb ist das Msaho in Zavala gestorben. Überall herrscht die Macht der Waffen und die Piraterie der Waffen. Verdunstet ist das Wasser, das die Geschicke der Menschheit benetzt, alles ist Feuer. Frau und Mann, stark und schwach, Feuer und Wasser ziehen im Kreis wie die Jahreszeiten. Eins stirbt und ein anderes kommt, niemals gehen sie gemeinsam in Richtung der Harmonie der Natur. Die Worte Hunger, Krieg, Streik, Flucht, Massaker, Raub, Unglück bestimmen heute den Wortschatz der meisten. Die Schritte der Menschen sind keine Spaziergänge mehr, sondern Protestmärsche. Worte wie Macht oder Revolution klingen wie ein Fluch in den Ohren, die taub geworden sind von der Gewalt der Explosionen im Namen der Demokratie. Das Blutvergießen ist durchdacht, geplant, in guter Absicht und mit einem edlen Ziel. Menschenleben sind Haare, sagen die Krieger, man schneidet einige ab und viele wachsen nach, stärker, gesünder. Tag für Tag gibt es weniger Schulen, weniger Arbeit, weniger Regen, mehr Feuer, mehr Sonne, mehr Waffen. Es gibt mehr Tote als Lebende, aber noch immer ist das Ende der Welt nicht gekommen, das Leben wird siegen dem Sieger zu Ehren. Der Sieger dieses Krieges wird seinen mächtigen Palast aus Menschenknochen errichten, die es im Busch zu Tonnen gibt. Es regnet. In jedem Winkel verstecken sich Lebewesen und schöpfen neue Kraft. Draußen schneidet die Kälte, gefriert, wie eine geschliffene Klinge. Es ist Winter, es ist Juni. In der Oberstadt wird Strom unter Volldampf verbraucht und beheizt die Häuser der Reichen. Die Armen, sie machen es sich in den Armen ihrer Liebsten bequem. Keine Decke zu haben und keinen Liebsten um sich zu wärmen, bedeutet, im Juni der Ärmste der Armen zu sein. Der Himmel klart zögerlich auf, und die Menschen üben das Erwachen. Das Wetter spricht für die Wärme des Bettes, doch der Komfort ist das Vorrecht der Reichen. Die Arbeiter wachen auf. Auch ohne sich das Gesicht zu waschen oder die Zähne zu putzen gehen sie aus dem Haus und strömen zusammen zum Marsch der Massen auf der großen Straße, denn in wenigen Minuten heulen die Fabriksirenen. Aus der Menge schauen die Arbeiter nicht zum Himmel hin- auf, nicht zur Seite und schon gar nicht in die Gesichter derjenigen, die sich in dieselbe Richtung bewegen. Sie schauen zu Boden, auf schwarzen Asphalt, so schwarz wie die Zukunft, ihre Träume und ihr Leben. Sie schauen nach hinten, suchen Trost in den guten Momenten vergangener Zeiten. Jemand in dem schweigenden Marsch kommt auf die Idee, sein Radio einzuschalten und hofft, die Musik des erwachenden Morgen zu hören. Das Radio sagt nicht guten Tag zu den Leuten, kein sanftes Wecken, das Hoffnung macht. In der heutigen Zeit machen Radios mit dem Tod gemeinsame Sache. Der Sprecher verkündet den Tod. Von Menschen in Kämpfen, Massakern und Raubzügen. Er redet von Menschen, gestorben an Hunger, an Durst, an der Verzweiflung im Land. Der Sprecher im Radio ist ein Botschafter des Todes, und er macht seine Arbeit voll Einfalt und gewissenhaft. Seine Nachrichtensendung möchte nichts anderes sagen als: Ich bin der Tod! Ich bin der König der Dunkelheit! Wo auch immer du bist, wach auf, hör mir zu, mach dich bereit, denn ich werde auch dich holen, der du noch schläfst und schnarchst. Heute sagt der Sprecher, der Krieg geht zu Ende. Er spricht überzeugt, vielleicht hat ihm jemand verbindliche Zusagen gemacht. Die Menge hört ihm nicht zu, trottet weiter, denn selbst wenn der Krieg der Waffen aufhört, der Krieg um das Brot und die Rechte der Menschen ist noch lange nicht zu Ende. Jetzt redet der Sprecher von Streik. Der Arbeiter dreht lauter. Die Menschen bleiben stehen und hören. »Im Volkseigenen Betrieb der Zuckerindustrie sind fünf Männer bei Auseinandersetzungen mit der Polizei ums Leben gekommen. Der stellvertretende Leiter des Betriebes wurde von den Streikenden schwer verletzt. Die Auseinandersetzung ist inzwischen im Sinne der Arbeiter beendet worden, die eine Lohnerhöhung von fünfzig Prozent erhalten.« Die Arbeiter nehmen ihren Gang wieder auf, traurig, denn alle Streiks laufen auf das gleiche hinaus: Demütigung, Kämpfe und Tod. Die fünfzigprozentige Lohnerhöhung ist nur ein scheinbarer Sieg, denn sie wird aufgefressen vom steigenden Brotpreis. Unter dem schwarzen Boden des Asphalts bedauert die Erde die Menschen, die auf sie treten. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Zu gegebener Zeit wird sie ihren fleischgierigen Schlund aufreißen und diese Elenden aus Muskeln und Wasser mit einem makabren Grinsen verschlingen. Der Tod kreist über den Männern, die hastig die Straßen der Großstadt bevölkern, doch sie sehen ihn nicht. Sie träumen. Wollen noch mehr Frauen heiraten und mehr Kinder bekommen, damit ihre Generationen sich in alle Ewigkeit fortpflanzen. Die Frauen denken an die Kinder, die Arbeiter von morgen. Bei den Jungen weckt der Traum von der Zukunft heimliche Wut. Um das Morgen zu erringen, muss man die Ärmel aufkrempeln und die Kämpfe des Heute gewinnen. David macht Licht an und schaut auf die Uhr. Es ist halb fünf Uhr morgens. Er schaltet das Radio ein, um die Morgennachrichten zu hören. Der Streik der Arbeiter in der Zuckerindustrie klingt für ihn wie das Klirren von Schwertern. »Mein Gott, was soll das nur werden?« Die Verzweiflung ergreift seine Gemüt, wie ein Verurteilter kurz vor dem Tode. Zeichen der Zeit, ärgert er sich, Zeichen des Wandels. Die Vergangenheit spiegelt sich wieder in neuem Gewand. Er geht zum Fenster und schaut nach der Sonne. Der Morgen ist verregnet. Trist. Der Wind scheucht dichte Wolken vor sich her, die unvorstellbare Angst in sein Gemüt dringen lassen. Böse Gedanken quellen heraus, wie ein Brunnen mit fauligem Wasser, sein fetter Körper erschlafft in Sekunden. Die Gesichter der Arbeiter des Staatsbetriebes, den er leitet, nehmen Gestalt an. Er denkt an seine Arbeit. Seine Leistungen sind kritikwürdig. Er rechnet. Seit vierundzwanzig Monaten haben die Arbeiter in der Zuckerindustrie keinen Lohn mehr erhalten. Seine haben erst seit sechs Monaten keinen Lohn. Eine kurze Zeit. Verglichen mit anderen Direktoren ist er ein Heiliger. Es gibt Gründe für den Rückstand. Er hat einige Mittel entnommen, um ein neues Fahrzeug zu erwerben und den vierzigsten Geburtstag von Vera, seiner Frau, angemessen zu feiern. Andere Mittel hat er entnommen, um Aktien eines großen Unternehmens zu kaufen. Von Unterschlagung oder Diebstahl kann keine Rede sein. Es war eine Transaktion, eine Art Anleihe zur Bildung von Kapital, das zu gegebener Zeit zurückerstattet werden wird. Ein Direktor, der auf sich hält, muss eigenes Kapital haben und eine öffentliche Erscheinung, die seiner Position entspricht. Er überlegt emotionslos. In dieser Welt ist niemand gut zu anderen. Der eine betrügt den anderen. Weiße Tyrannen ersetzt durch schwarze Tyrannen, das ist die Moral der Geschichte. Tyrannei ist die rechtmäßige Tochter der Macht. Gerechtigkeit, Gleichheit gehen nur Gott etwas an und haben nichts mit den Menschen zu tun. Bilder einer großen Vergangenheit ziehen durch seine Erinnerung wie Fotografien. Militärische Ausbildung und Krieg gegen den Kolonialismus, Märsche, Gefechte. Sabotage. Versammlungen. Reden. Parolen. Begeisterung, Träume, Überzeugungen. Schließlich der Sieg über den Kolonialismus. Kollektiver Taumel am Tag der Befreiung. Voller Sehnsucht erinnert er sich an die Studienkreise in revolutionärer Politik. Erinnert sich an die Sprache von früher. Genosse Kommandant, Genosse Vater, Genossin Frau, Genosse Chef. Freundschaft, Solidarität, echte Kameradschaft. Damals hatte er ein Herz so groß wie ein Volk, und heute ist es so klein, dass es nur noch sich selbst darin unterbringt. Heute ist das Volk nur noch eine Zahl, ohne Alter oder Geschlecht. Ohne Träume und Wünsche. Reine Statistik. »In die Revolution habe ich investiert. Jetzt ist die Zeit des Egoismus. Ich will all das ernten, was ich gesät habe. Meine Position als Direktor war kein Geschenk, sondern eine Errungenschaft. Ich habe für die Freiheit dieses Volkes gekämpft.« Er legt sich wieder ins Bett. Vergräbt den Kopf in den Kissen, entschlossen, seine bösen Gedanken zu vergessen. Er schläft ein. […] |