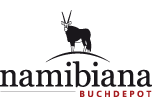| Autor: Wilhelm Heinrich Laakmann
Herausgeber: Detlef Frormann
Klaus Hess Verlag
Göttingen; Windhoek 2006
Broschur, 15x21 cm, 168 Seiten, 137 farbige, 66 sw-Abbildungen Namibia steht nicht nur für einzigartige Natur, afrikanische Weiten und interessante Menschen, sondern beinhaltet auch gleichzeitig immer ein Stück deutsche Vergangenheit. Wer nach Namibia reist, wird unweigerlich damit konfrontiert. Die Kolonialzeit hat ihre Spuren hinterlassen. Ein altes Tagebuch lässt diese Spuren wieder lebendig werden: Sergeant Richard Christel bereiste in den Jahren 1905-1907 als Frachtfahrer der Kaiserlichen Schutztruppe die Weiten Namibias. Seine - teils recht abenteuerlichen - Erlebnisse zeichnete er später schriftlich auf und gewährt dem Leser heutzutage einen Einblick in die damalige Zeit. Fast hundert Jahre nach diesen Ereignissen fielen die Schriftstücke Wilhelm H. Laakmann zu, der sich zusammen mit seiner Frau auf Spurensuche in Namibia begab, um die Schilderungen des Sergeanten aus heutiger Sicht dokumentieren und kommentieren zu können. Eine Großzahl der geschilderten Plätze fand sich auch heute noch wieder. Die in diesem Buch mit viel Humor und Selbstironie beschriebenen Reise- und Jagderlebnisse des leidenschaftlichen Jägers in Namibia und Deutschland schlagen die Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Namibia und Deutschland und geben dem alten Tagebuch einen unterhaltsamen Rahmen. Weg: Okahandja - Otjimbinde und zurück,
Zeit: 29.01.-08.03.1905
Kommando: Sergeant Walter, Regierungstransport
Mannschaft: 1 Unteroffizier, 7 Reiter
Verhältnisse: Pad schwer, Wasser schlecht, Weide gut „Am zweiten Reisetag nachmittags um 5 Uhr erreichten wir Okahandja, nachdem wir mehrere Stationen passiert hatten, die überfallen und ausgeplündert worden waren. Es war mir eine besondere Freude, in Okahandja meinen früheren Leutnant Jäschke von der 2. Proviantkolonne in China zu treffen. Er war ebenso erstaunt, einen Kameraden aus China wiederzusehen. Damals glaubten wir beide, an die richtige Stelle gelangt zu sein, um unser Land zu verteidigen. Ich wurde der l. Kolonnen-Abteilung zugewiesen. Zunächst folgte Appell auf Appell mit Ausnahme des 27. Januar, an dem wir Festgottesdienst hatten (Kaisers Geburtstag). Da ich wusste, dass mein Vetter Georg Flamm in Okahandja stationiert war, machte ich mich nach dem Gottesdienst auf die Suche nach ihm. Es gelang mir auch, ihn zu finden. Er hatte eine Mühle zum Schroten des Getreides gebaut und versah hier seinen Dienst. Am 29. Januar 1905 wurde ich auf Transport nach Otjimbinde kommandiert. Unter Führung des Sergeanten Walter rückten wir mit einem Uffz. (Unteroffizier) und sieben Mann Bedeckung, einem Bur als Dolmetscher und zehn Treibern für fünf Ochsenwagen ab. Am ersten Tag kamen wir nur einen Kilometer weit, da sich zwei Wagen festgefahren hatten. Deshalb mussten sie entladen werden. Erst am folgenden Tag hatten wir nach mühseliger Arbeit die Wagen frei und schafften vier Kilometer. Wir rasteten noch einen Tag und verstauten die Fracht ordnungsgemäß. Unsere Ochsen, die im Busch weideten, hatten sich drei Kilometer weit in Richtung auf die nächste Wasserstelle von unserem Rastplatz entfernt. Sergeant Walter schickte die Reiter Ambos, Engelbrecht, Gabriel und mich zu der Wasserstelle, um die Ochsen zurückzuholen. Gerade waren wir einige hundert Meter gegangen, als unser Kamerad Ambos zwei große Schlangen auf einem Baum liegen sah, der unmittelbar am Ufer des Swakop stand. An Schießen war nicht zu denken, weil wir auf keinen Fall unsere Gegner auf uns aufmerksam machen wollten. So eröffneten wir ein regelrechtes Bombardement mit Steinen, die sich reichlich am Ufer des Swakop fanden. Die Schlangen verließen darauf ihren Platz und verschwanden in einem Loch unmittelbar am Wurzelwerk des Baumes. Obgleich Engelbrecht und Gabriel zurückwichen, fasste ich das eine Exemplar beim Schwanz und zog es durch meine Beine dem hinter mir stehenden Kameraden Ambos zu. Als der den Schwanz gefasst hatte und zog, wartete ich auf den Kopf und zerschmetterte ihn mit dem Stiefelabsatz. Wir brachten das zwei Meter lange Ungeheuer zu unserem Frachtwagen. Wachtmeister Schmidt, der gerade mit einem Leertransport bei uns eingetroffen war, zeigte großes Interesse für meine "Beute". Ich habe sie ihm geschenkt. Inzwischen hatten die Treiber unsere Ochsen zurückgebracht. Wir konnten die Fahrt fortsetzen. Die Pad (Weg, Straße) durch den Schwemmsand des Swakop war äußerst mühsam und wir hatten Schwierigkeiten, jeden der mit vierzig Ochsen bespannten Wagen durch das Flussbett zu bekommen. Nach drei Kilometern Tagesstrecke mussten wir einen weiteren Rasttag einlegen. Am 2. Februar schafften wir insgesamt vierzehn Kilometer. Nach kurzer Pause vermissten wir am 3. Februar zehn Ochsen, die Ambos und ich wiederfanden und dem bereits abgefahrenen Treck nachtrieben. Unterwegs machte mich Ambos auf ein nahe an der Pad sitzendes krokodilähnliches Tier aufmerksam. Da wir erst kurze Zeit in Afrika waren, kannten wir das Tierleben nicht genügend. Aus Sorge um unsere Zugochsen gingen wir mit dem Seitengewehr auf die Bestie los. Zunächst hatten wir den Eindruck, als wolle sich das Ungeheuer auf uns stürzen. Dann aber verschwand es in einem großen Loch neben der Pad. Wir nahmen unsere Gewehre und drückten ab, um die Gefahr endgültig zu beseitigen. Dann zogen wir das leblose Tier aus dem Loch. Die Eingeborenen erklärten uns später, dass es ein Waran (War'ane, arabisch) war, eine der vorzeitlichen räuberischen Echsen, die bis zu zwei Meter lang werden können. Die Pad wurde so steinig und holprig, dass wir jeden Augenblick fürchteten, die Wagen würden umstürzen. An diesem Tag, dem 4. Februar, betrug unsere Tagesfahrstrecke vier Kilometer. Mächtige Bergrücken lagen quer zu unserer Pad. Wir mussten rasten, um den Zugtieren Ruhe zum Aufbau neuer Kräfte zu geben. Für die Sicherung in der Nacht waren die Wagen auf der linken Seite der Pad hintereinander aufgefahren. Auf der rechten Seite entzündeten die Treiber ein großes Feuer, das sie vor der Nachtkälte schützen sollte. Sie hatten sich möglichst nahe darum zur Ruhe gelegt. Der wachhabende Posten bemerkte auf seinem Patrouillengang, dass sich unmittelbar am Feuer etwas bewegte. Als er sich näher herangeschlichen hatte, erkannte er einen großen Pavian, der sich an den Resten der Abendmahlzeit zu schaffen machte und die von ihm erwählten Leckereien verzehrte. Da an Schießen nicht zu denken war - die Treiber hätten getroffen werden können -, weckte uns der Reiter Gabriel. Als wir herbeiliefen, machte sich der Pavian schleunigst aus dem Staube. Die Treiber hatten von der ganzen Sache nichts bemerkt, obgleich sie unmittelbar am Feuer schliefen. Weil in der Nähe Wasser war, blieben wir bis zum 6. Februar und treckten dann auf der wirklich schlechten Wegstrecke weiter. Der Sergeant und der Unteroffizier fuhren mit drei Wagen voraus, wobei ich mit den zwei übrigen Wagen nur schlecht vorwärts kam. Die Fahrt war so anstrengend, dass ich nachts um 11 Uhr ausspannen musste, weil die Ochsen völlig entkräftet waren. Ich ließ sie nicht weiden, sondern bei den Wagen ausruhen. In scharfem Galopp versuchte ich auszukundschaften, wie weit die übrigen Wagen schon von mir entfernt waren. In stockfinsterer Nacht jagte ich dahin, meinem Pferde die Führung lassend. Plötzlich machte es einen Sprung zur Seite und raste mit mir weiter in den Busch. Ich hatte alle Mühe, es wieder auf den Weg zu bringen. Bis zu diesem Zwischenfall mochten zehn Minuten verstrichen sein. Zunächst konnte ich mir über die Ursache nicht ganz klar werden. Dann aber ließ der üble Geruch, der uns entgegenschlug, ahnen, warum das Pferd scheute. Kaum zwei Minuten später bäumte sich mein Pferd wieder auf und es war nur mit großer Mühe zu beruhigen. Hier konnte ich einen verendeten Ochsen erkennen, von dem der bestialische Geruch ausging. Solche Kadaver liegen wie Meilensteine an den Treckwegen. Um 12 Uhr nachts traf ich bei den vorderen Wagen ein, wo ich meinem Vorgesetzten über den augenblicklichen Standort meines Trecks Meldung machte. Dann ritt ich zurück und brach mit meinen Fahrzeugen nachts um 3 Uhr auf. Um 8 Uhr morgens trafen wir bei den vorausgefahrenen Wagen ein und erreichten am nächsten Tag Otjusasu. Wir hatten in zehn Tagen insgesamt 29 Kilometer bewältigt. In Otjusasu wurden zwei Rasttage ein-gelegt. Wir sahen Kapitän Zacharias (Kapitän = Anführer, Häuptling) und einige seiner Leute, die als Gefangene nach Okahandja gebracht wurden. In der Nacht wurden uns von der Weide zwei Pferde gestohlen, die wir nicht wiederbekamen. Otjusasu war vor dem Krieg eine Missionsstation. Heute (1905) ist alles dem Erdboden gleichgemacht. Es hat hier zu Beginn des Krieges schwere Gefechte gegeben. Auf dem weiteren Weg, der teils besser, teils noch schlechter war als vorher, wurden wir nachts häufig alarmiert, weil unsere Gegner immer wieder versuchten, die Zugochsen wegzutreiben. Obgleich wir den Viehdieben sofort nachstellten, hatten wir keinen Erfolg. Sie verschwanden im dichten Buschwerk wie vom Erdboden verschluckt. Am 14. Februar erreichte unser Treck Owikokorero. Einen Teil der Fracht übergaben wir der dort stationierten Kompanie. Viele Kameraden der Truppe sind hier gefallen und auf dem nahe gelegenen Friedhof beigesetzt. Wegen der geringeren Ladung konnten wir den weiteren Weg zügiger fortsetzen. Wir mussten mehrere wassergefüllte Vertiefungen durchqueren, die man hier zu Lande ,Vley’ nennt. So gelangten wir nach Ojosondu, wo ein weiterer Teil der Ladung zurückblieb für das dort gelegene Feldlazarett und eine Reservekompanie. Nach weiteren zwei Tagen erreichten wir unseren Bestimmungsort Otjimbinde. Dort blieb dann der Rest unserer Fracht. Am 25. Februar begann die Rückreise und statt der Fracht hatten wir verwundete und kranke Kameraden geladen. Den Ausgangsort Okahandja sahen wir am 8. März wieder. Von den 100 Zugochsen hatten wir 25, hauptsächlich durch Entkräftung umgekommene Tiere, verloren." Die Niederschrift dieses Büchleins verdankt seine Entstehung einer zufälligen Begegnung auf der Jagdausstellung "Jagd & Hund" in Dortmund Ende Januar 2004. Ein Herr neben mir, an einem Stand der namibischen Jagdfarmen, verfolgte mit Interesse die Vorstellung meines ersten Bandes „Namibia mit Zeichenstift, mit Kamera und Büchse". Als er sich spontan ein Exemplar sicherte und erwarb, bot ich ihm an, das Buch zu signieren. Er revanchierte sich, indem er mir die Kopie von Notizen überreichte, die sein Großonkel als Sergeant der Kaiserlichen Schutztruppe während der Auseinandersetzungen in Deutsch-Südwest-Afrika in den Jahren 1905-1907 als Teilnehmer und Transportleiter im Nachschubwesen aufgezeichnet hatte. Wie so häufig schlummerte sie in der leider stets überfüllten aktuellen Ablage meines Schreibtisches und hatte zunächst keine Chance auf Wiederbelebung, da sich in der Regel Tagesaktualitäten in den Vordergrund drängen. Die Zeit der Bockjagd rückte näher und damit auch die üblichen Vorbereitungen. Das Überprüfen von Waffen und Ausrüstung ist Routine, die Wahl von Stiften und Skizzenblocks immer ein penibles Ritual, die leicht vergammelte Lesebrille in dem blechernen Etui aus Bundeswehrzeiten in abgegriffenem „Nato-Oliv" ist Standard im abgetragenen Rucksack, der nach vierzig Gebrauchsjahren zur Ergänzung einer Vogelscheuche ein ausgezeichnetes Requisit wäre. Nun fehlte nur noch die Lektüre, auf die ich immer besonderen Wert lege, weil ein Hochsitz oder eine Kanzel die besten Sitzgelegenheiten sind, um in Muße und ohne jedwede Störung so manches Kapitel in sich aufzunehmen. In irgendeinem Winkel altersbedingter Vergesslichkeit fand sich mehr zufällig das Tagebuch, das im DIN A4-Format zwar nicht besonders handlich ist, sich aber wegen seiner flexiblen Ordnerhülle fast jeder Wölbung des Rucksacks anpasste. Ein schöner Sommertag hatte den Zenit überschritten und eine leicht drückende Wärme lag über der Feldflur, als ich den Pirschpfad entlang des Maisschlages zwischen der Hecke und dem zum Rinnsal mutierten Bachlauf in Richtung auf die Ansitzkanzel nahm, den wir hochtrabend „Königsthron" genannt haben. Vier mächtige Stämme, fast dreißig Zentimeter im Durchmesser, in der Erde mit Bitumen umhüllt und mit Metallankern gesichert, bilden die Stützkonstruktion. Darauf ruht in acht Metern Höhe eine „Hütte", etwa 180 cm im Geviert mit einem Walmdach, das nach allen Seiten einen halben Meter Überstand hat. Auf richtige Fenster haben wir verzichtet, statt dessen an jeder Seite solide, hochstellbare Blendläden montiert, die innen mit ebenso soliden Vorhängeschlössern gesichert werden können. Auf der Südseite ist die Anstiegleiter nahezu unsichtbar durch üppig wuchernde Brombeerbüsche, wild schießenden Holunder und sperrige Haselnusssträucher. Leider ist die Eingangstür ein wenig schmal geraten. Aber bei Errichtung des Thrones waren wir alle noch etwas schlanker. Der kleine Mischwald und die sieben Buchenüberhälter spenden Schatten und bilden einen prächtigen Sichtschutz. Um zwei Jägern in dem geräumigen „Pfahlbau" eine Chance zu geben, stehen zwei nicht mehr neuwertige, auf Rollen bewegliche, gut gefettete Bürostühle auf dem mit einer dicken Gummimatte ausgelegten Dielenboden. Die Fensterbrüstungen haben Auflagen aus soliden Gummiprofilen, wie sie seit den 60er Jahren Standard bei Handläufen in allen öffentlichen Neubauten waren. Trotz des massiven Gummieinsatzes ist unser „Hochhaus" geruchsneutral - auch bei warmer Witterung - und vor allem geräuschdämmend, was bei einer Sitzkorrektur sehr angenehm ist. Mit einer Art Yogaübung hatte ich mich durch die Tür gezwängt. Als alle Luken offenstanden, ging ein leiser Luftzug, der bei der Wärme draußen äußerst willkommen war. Nach dem obligatorischen Rundumblick mit dem Glas richtete ich mich gemütlich ein. Hut, Rucksack, Glas und die gute alte Bockbüchsflinte hingen an den kräftigen Haken, die wir seinerzeit zu diesem Zweck in die Trägerbalken der vier Ecken geschraubt hatten. In dem Flintenlauf steckte der Magnumlauf 5,6 X 50 R, womit ich mich für jede Situation gewappnet fühlte. Meinen Stuhl hatte ich in die Ecke geschoben, wo das Fernglas hing, und dem Rucksack die lange vernachlässigte Kladde entnommen, um sie erstmals in aller Seelenruhe durchzulesen. Die Füße auf den Sitz des zweiten Stuhles hochgelegt, hatte ich die richtige Stellung eingenommen. Meiner aus Kindertagen überkommenen Gewohnheit gemäß ließ ich die einzelnen Seiten über den Daumen gleiten, um nach Bildern oder Abbildungen zu suchen. Tatsächlich, fast am Ende fand ich eine Karte der damaligen Kolonie Deutsch-Südwest und auf dieser Karte unterschiedlichste Wegmarkierungen, die einer beigefügten Legende nach die verschiedenen Reise- oder Transportrouten im Lande darstellten. Als ich Ortsnamen und Wegführungen wiedererkannte, wo meine Frau und ich im heutigen Namibia auf sechs langen Reisen unterwegs gewesen waren, wurden diese „Pads" zu lebendigen Bildern und die Namen wie „Otjiwarongo", „Okahandja", „Otjimbingwe" und viele andere mehr zu klingender Musik. Ich war derartig gefesselt, dass ich Ort und Zeit vergaß. Die Idee, dieses Tagebuch mit seinen Routen zu entschlüsseln, entstand spontan und nachhaltig. Die Zeit verging schneller als erwartet und der Sonnenstand hatte sich verändert. Ich packte das Heft zurück in den Rucksack und entschied, es als vorrangig am Schreibtisch zu behandeln. Nun konnte ich wieder Vogelstimmen hören und bei dem vorsichtigen Blick über die Brüstung der Kanzel sah ich den „Hasen vom Dienst", der sich an den Gräsern und Löwenzahnblättern am Feldrain gütlich tat. Ein stattlicher Bursche, der gewiss mit einiger Lebenserfahrung schon manche Treibjagd im Herbst überstanden hatte. Es war der reine Genuss, Meister Lampe bei seinem ausgiebigen Abendbrot zuzusehen. Krähen querten mit müdem Schlag die große Feldfläche zwischen dem Waldstück an der großen dahinterliegenden Bundesstraße und meinem Standort. Von einem Stück Rehwild oder gar dem erträumten Bock weit und breit keine Spur. Blieben also der dickfellige Hase am Feldrand, die lästigen Fliegen und die fette Spinne in ihrem gewirkten Netz im First der Bedachung die einzigen Zeitgenossen, mit denen ich kommunizieren konnte. Wie lange ich da so hockte und besonders dem Hasen aufs Maul geschaut habe, weiß ich nicht mehr. Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr. Nichts Bestimmtes, als ich länger hinsah. Doch dann bemerkte ich, wie sich einige mickerige Maisstängel am Rande des Feldes leise bewegten. Mit dem Glas erkannte ich den spitzen Fang, der sich im Zeitlupentempo hervorschob. Aha, Reinecke hatte einen feisten Braten gewittert, das konnte ja noch gut werden. Langsam schob sich der rote Schleicher vor. Jetzt konnte ich den Kopf eines knapp Halbwüchsigen erkennen und wartete gebannt auf das Schauspiel, das ich sozusagen privatissime auf der Bühne des lieben Gottes geboten bekam. Die bereit gehaltene Büchse konnte ich getrost absetzen. Das Füchslein hatte wohl irgendein Geräusch verursacht, das Lampe innehalten ließ. Hatten seine Löffel während seines Festmahls ununterbrochen nach allen Seiten die Gegend abgehorcht, jetzt waren sie genau auf den Fuchs gerichtet. Lampe schien der Appetit vergangen zu sein, aber er rührte sich nicht. Der Fuchs wirkte wie ein Tierpräparat in einem Schaukasten, kein Barthaar zuckte. Lampe wollte die Situation klären, wandte sich Richtung Fuchs, machte Männchen und versuchte, mit seiner Kurzsichtigkeit hadernd, irgendeine Bewegung zu erspähen. Nichts. Nach kurzer Zeit begann der verfressene Rammler aufs Neue mit seiner Mahlzeit und wandte sich wieder den gebotenen Leckereien zu. Der Fuchs, nunmehr seiner Beute sicher, pirschte sich kaum merklich vorwärts. Die Entfernung zwischen Fuchs und Hase war kaum auf fünf oder sechs Gänge geschmolzen, als plötzlich Lampe mit zwei Riesensätzen genau vor dem Fuchs landete und aufrecht sitzend dem angehenden Schlaumeier eine ungeheure Tracht Prügel verabreichte, indem er in rasendem Tempo mit den Vorderläufen auf die ihm widerliche Visage des Halbstarken trommelte. Der Fuchs - seinerseits völlig fassungslos - bemerkte erst nach einigem Trommelfeuer, dass er hier den Kürzeren zog. Wahrscheinlich hatte mein schallendes Gelächter die Abreibung für den Fuchs verkürzt. Ein in jeder Hinsicht spannender Jagdtag war zu Ende. Tief beglückt wanderte ich zum gemeinsamen Treffpunkt mit den Freunden - der Jagdhütte in der Haardt. Unterwegs wurde mir klar, was ein „Hasenfuß" ist: Ein Mike Tyson mit Baseballschlägern im Tierreich. Und es gibt solche, an denen auch ein wesensfester Hund nicht eine Pfote vor die Hütte setzen möchte. Erstere nennt man Jagdtage, die anderen „Jägertage". Jägertage deswegen, weil es für alternde Weidgefährten erheblich gemütlicher ist, in der wetterfesten Hütte zu hocken, mit Freunden zu plauschen und bei Pfeifenrauch und einem Glas würzigen Roten alte Erlebnisse in neuer Fassung zum Besten zu geben. In unseren Breiten sind in manchen Jahren die Jägertage eindeutig in der Mehrzahl. Du brichst auf, vertraust deinem Glück und baust auf die Einsicht und das Wohlwollen des berühmtesten Fischers. Doch dann dreht Petrus die Schleusen auf und heraus kommt ein Jägertag. Leider wurde auch aus diesem Freitag ein Jägertag/ allerdings ohne Klönen mit Gefährten, ohne Roten und durchaus ungemütlich. Morgens bei der Abfahrt war der Himmel so klar und wolkenlos wie nur ein Mittsommermorgen sein kann. Die sechzig Kilometer von zu Hause um 4 Uhr früh - eine Wonne für jeden, der freie Autobahnen liebt. Bei der Ankunft an unserer Hütte zogen einige silberne Zirrusfäden über den makellosen Himmel, die durch die aufgehende Sonne eine leicht rosa Färbung erhielten. Dem Gras hafteten kaum Tauperlen an und doch roch die Luft ein wenig feucht. Das Hütten-Thermometer zeigte beachtliche 19° C an, alles in allem sichere Anzeichen für einen Tag, der noch einige Überraschungen im Gepäck haben konnte - mindestens für nüchterne Realisten oder gar skeptische Pessimisten. Da ich Sonntagskind bin, gehöre ich weder zu der einen noch zur anderen Gruppe und bereitete mich innerlich auf einen schönen Pirschtag und einen gemütlichen Abendansitz vor. Zwar stritten - wie meistens - die mir innewohnenden Leidenschaften miteinander: Malen oder Jagen. Diesmal gewann die Jagd haushoch nach Punkten. Der nahezu ausgeknockte Maler wurde zum Jäger. Skizzenblock und Stifte behielten ihren sicheren Platz im Rucksack, doch der Bergstutzen dominierte eindeutig. Die Vogelstimmen, übertragen durch meine Hörgeräte Marke „digital extra scharf", zeigten deutlich an, dass die leuchtend vor mir liegende Natur erwachte und lebendiger wurde. Am liebsten hätte ich mit den Vogelstimmen konkurriert, aber das wäre zweifelsfrei der dümmste Start für eine hoffnungsvolle Pirsch gewesen. Die Pirschstiefel mit den weichen Kautschuksohlen ermöglichen ein nahezu lautloses Auftreten auch bei Kies und Schotteruntergrund. Nach zehn Minuten auf dem festgefahrenen Wirtschaftsweg bog ich in einen Buchenhain ein, wo der leicht feuchte, laubbedeckte Boden mit den prächtig sprießenden Waldgräsern einen wunderschönen Teppich bildete. Am Rande des Wäldchens mit mittelprächtigen Buchen hatten wir vor Jahren eine Schütte für Fasanen und eine überdachte Raufe für Reh- und Damwild gebaut, um in der härtesten Jahreszeit einen Überlebensvorrat ausbringen zu können. In den letzten Jahren bestand auf Grund der milden Witterung kein Bedarf dafür. Weil ich vergammelnde Jagdeinrichtungen auf den Tod nicht ausstehen kann, führen mich die Pirschgänge fast unterbewusst immer an Hochsitzen, Ansitzleitern, Ansitzgruben, Fütterungen, Übersteigtreppchen für Weidezäune oder Schutzhütten für das Weidevieh vorbei. Dabei ist der im Laufe der Jahre hochentwickelte „Bauschädenblick" eine untrügliche Hilfe. Schadstellen werden mit einem Farbklecks aus der Sprühdose markiert, um jeden der Jagdkameraden daran zu erinnern, dass schnellstmögliche Instandsetzung nötig ist. Mich nach Westen haltend, schlenderte ich mehr als pirschend über einen kleinen Brachstreifen. Hier trifft man auf einen Feld- weg, der Gott sei Dank noch nicht asphaltiert wurde. Mit dem Glas leuchtete ich den rechter Hand liegenden Buschwald ab, der sich im weiteren Verlauf zu einem etwa hundertfünfzig Hektar großen Mischwald ausdehnt. An diesem Rand liegt seit Generationen eine der Lieblingsäsungsflächen von Rehen und gelegentlich auch Damhirschen. An den Feldrändern hoppeln regelmäßig Kaninchen, um bei vermuteter Gefahr blitzartig in ihren Löchern zu verschwinden. Der etwa zweieinhalb Kilometer entfernte Hof wirkt wie ein kleines Juwel im Licht der aufgehenden Sonne. Es ist die Landschaft, in der ich mich wohl fühle, in die ich geboren wurde, der meine Eltern, Großeltern und die meisten Vorfahren entstammen, es ist meine Heimat.
Bevor ich den leicht ansteigenden Acker überquerte, prüfte ich nach jedem Schritt den Waldrand, um nicht schon im Vorfeld alles zu vermasseln. Inzwischen waren aus den durch die Jetstreams langgezogenen Zirrusfäden kleinere Wolkenflächen und Haufenwölkchen entstanden, die ich weder beachtete noch in mein weiteres Kalkül einbezog. Am Waldrand konnte ich nicht ein Haar entdecken, das auch nur annähernd einem Stück Rehwild zuzuordnen gewesen wäre. Vorsichtig schob ich mich bei gutem Wind durch den Buschwaldstreifen, hinter dem eine gern angenommene Lichtung lag, der sich der eigentliche, größere Mischwald anschloss. Erleichtert lehnte ich meinen neuen Ansitzschemel gegen eine der einzeln stehenden Kiefern und machte es mir bequem. Ein Drosselmännchen hackte mit Inbrunst in dem lockeren Boden, um Kleininsekten und Würmer wie mit einer Pinzette hervorzuziehen. Meisen hüpften geschäftig im Geäst der Sträucher, und ich konnte mich gegen den Stamm der Kiefer lehnen und nur zuschauen. Rechts von mir raschelte ein Waldmäuschen im knisterdürren Laub und für Augenblicke konnte ich ihm in die dunkelglänzenden Knopfäuglein schauen. Die possierliche Emsigkeit, mit der der kleine Nager hin und her huschte, erinnert mich an Zeitrafferaufnahmen aus großen Städten, die man gelegentlich wie „Augenpulver" im Fernsehen als progressive Reklame geboten bekommt, ohne zu wissen, für welches Produkt geworben wird. Menschen eilen über Straßen, halten ruckartig an, wechseln die Richtung und alles mit einer Geschwindigkeit, dass das Auge kaum zu folgen vermag. Es erscheint einem wie ein sinnloses Durcheinander und folgt doch einer planvollen Ordnung. Dem Mäuschen mit dem Blick zu folgen ist leichter als den TV-Bildern, weil man das Sinnvolle der Geschäftigkeit erkennen kann und zu deuten vermag. Fernes Grummeln drang an meine Ohrersatzteile. Ein Blick über die Schulter nach Westen beflügelte mich, möglichst rasch den Rückweg zur Hütte unter die Läufe zu nehmen. Der Himmel war nahezu schwarz in der Blickrichtung. Entsprechend hastig gestaltete sich mein Rückzug. Mir schien, das herannahende Gewitter könnte schneller sein als ich. So holte ich aus den Tiefen meines Rucksacks den für den äußersten Notfall stets mitgeführten Plastikregenumhang aus seinem Transportbeutel und bemühte mich, den etwas aus dem Takt geratenen Herzmuskel mit zwei Hub „Nitro" zu beruhigen. Bei der kleinen Pause rückte das Wetter unaufhaltsam näher. Wind kam auf. Nun musste ich den Regenumhang schließen, denn die ersten dicken Tropfen landeten zielgenau in dem offenen Hemdkragen. Dem breitkrempigen Filz auf dem Kopf machte das alles nichts. Er schluckte die Tropfen fast lautlos. Auf meinem durch den Wind aufgeblähten Umhang platzten die dicken Wasserkugeln mit einem hässlichen Platsch. Als ich endlich das Vordach der Hütte erreicht hatte, rauschte der Regen bereits heftig auf das Dach und jeder Aufschlag ließ eine kleine Fontäne hochspritzen. Beim Aufschließen krachte es erstmalig recht heftig, als ob eine Panzerhaubitze an meinem Ohr abgefeuert würde. Tür zu! Stutzen in den Ständer, Hut und Regenhaut an den Haken, Rucksack auf den Boden neben den beiden Sesseln und dem Tischchen unter dem Doppelfenster, Schuhe auf den Trockenrost und Blendläden auf, Fenster auf. Fühlbar wich die warmstockige Luft - machte dem kühleren, würzigen Luftstrom, der herein floss, bereitwillig Platz. Von der Pumpe - wir hatten nämlich einen eigenen 18 Meter tiefen Brunnen, aber sonst keine Wasserleitung - holte ich mir eine Kruke Wasser und stellte befriedigt fest, dass alles in bester Ordnung war. Jetzt befand ich mich in unserer Festung, unter schützendem Dach. Draußen waren, wie man sagt, tausend Teufel los, und es blitzte und donnerte, als wolle die Welt untergehen. Der Platz im Sessel unter dem Fenster - man merkt, dass ich älter geworden bin - ist mir bei solchen Umständen immer der liebste. Die Landschaft in meinem Blickfeld verschwimmt, verliert die Konturen. Zeichnen oder Malen geht bei der Beleuchtung nicht. Aber zum Lesen reicht es noch allemal. Die Bücher und Zeitschriften im Regal kannte ich schon lange - Zeit, sie mal auszutauschen. Aber im Rucksack steckt immer noch die Kladde mit den Erinnerungen des ehemaligen Sergeanten der Kaiserlichen Schutztruppe, der in den früheren Kolonien in China und in Deutsch-Südwestafrika gedient hat. Ihm will ich ganz ungestört mein Ohr leihen. |