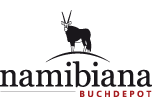Untertitel: Zur Historiographie eines umstrittenen Kolonialkrieges. Tagebuchaufzeichnungen aus dem Herero-Krieg in Deutsch-Südwestafrika 1904 von Georg Hillebrecht und Franz Ritter von Epp
Autor: Andreas E. Eckl
Reihe: History, Cultural Traditions and Innovations in Southern Africa volume 22
Rüdiger Köppe Verlag
Köln, 2005
ISBN 978-3-89645-361-7
Broschur, 16x24 cm, 302 Seiten, 1 Faltkarte, 23 sw-Fotos, 1 Skizze, Orts- und Personenindex
Der Herausgeber des vorliegenden Werkes, Andreas E. Eckl, gelangte vor über vier Jahren an das "Afrikanische Tagebuch" von Georg Hillebrecht aus dem Jahre 1904, das dieser in der Zeit seines Einsatzes als Oberarzt der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika im Krieg mit dem Volk der Herero führte.
Es handelt sich um Echtzeittagebücher, also um Aufzeichnungen, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den beschriebenen Situationen und Ereignissen stehen. Die Aufzeichnungen wurden demnach nicht von Bewertungen und Einschätzungen im Lichte späterer Erfahrungen überlagert.
Die Tagebucheinträge umfassen zwei Abschnitte des Krieges, die Zeit des 'eigentlichen' Krieges, der am 11. August beendet war, und die Auseinandersetzung danach.
So kann auf ihrer Grundlage der Fragestellung nachgegangen werden, inwieweit sich durch die veränderte Rolle und Funktion der Schutztruppe nach Hamakari auch die Sichtweise der Soldaten auf den Kolonialkrieg, die Bewertung der eigenen Rolle in diesem Krieg und das Selbstverständnis als Schutztruppensoldat gewandelt hat.
Die beiden Tagebücher von Hillebrecht und Epp werden hier zusammen publiziert, weil sie sich trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiede in Stil und Inhalt bestens ergänzen und das breite Spektrum persönlicher, individueller Perzeptionen des Kolonialkrieges verdeutlichen.
Ein Text voller Beobachtungen, Beschreibungen, Eindrücke, Ansichten und Reflexionen auf der einen Seite, militärisch knappe, präzise Aufzeichnungen weitgehend ohne persönliche Anmerkungen, die nur Wesentliches aus der militärischen Perspektive eines Soldaten festhalten, auf der anderen Seite.
Gerade die Zusammenschau beider Texte macht deutlich, dass eine verallgemeinernde Argumentation mit Blick auf die Rolle und das Verhalten der Schutztruppensoldaten der historischen Realität und der Vielfalt der einzelnen Charaktere nicht gerecht wird.
TEIL l: EINFÜHRUNG
Zur Historiographie eines umstrittenen Kolonialkrieges
TEIL 2: TAGEBÜCHER
Einleitung
Georg Hillebrecht: Afrikanisches Tagebuch
Ritter Franz von Epp: Tagebuch
Index der Personen- und Ortsnamen
„... aber wenn dir jemand das eine zeigt, wie kannst du dich dann beschweren, wenn anderen das andere in den Sinn kommt?"
Umberto Eco, Baudolino)
Am 12. Januar 2004 jährte sich zum hundertsten Mal der Beginn des Herero-Deutschen Krieges im ehemaligen Schutzgebiet Deutsch-Südwestafrika. Kein anderes Thema der deutschen Kolonialgeschichte Südwestafrikas hat seit diesem Tag bis heute auch nur annähernd viel Beachtung gefunden, kaum ein anderes Ereignis der deutschen Kolonialgeschichte ist Gegenstand derart kontroverser Diskussionen.
Durch die 2001 in den USA von Vertretern der Herero eingereichten zwei Klagen gegen deutsche Unternehmen1 und die deutsche Bundesregierung unter anderem wegen „Anzettelung und Durchführung eines Rassenkrieges" sowie einer „Kampagne des Genozids", vor allem aber durch die 100jährige Wiederkehr des Kriegsbeginns, aber auch im Kontext einer vergleichenden Genozidforschung, die in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen hat, erfährt die populäre und wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Kolonialkrieg von 1904 eine gesteigerte Aufmerksamkeit, die sich in Romanen, Dokumentarfilmen, Gedenkveranstaltungen, Wissenschaftskonferenzen, Ausstellungen und entsprechenden Publikationen niederschlägt. Einen besonderen Gegenwartsbezug erhält die Thematik zudem dadurch, daß noch heute etwa 25.000 Namibier im einstigen Deutsch-Südwestafrika leben, deren Muttersprache Deutsch ist.
Trotz, oder vielleicht gerade auch wegen der Popularität des Kolonialkrieges, könnten aber auch 100 Jahre nach seinem Beginn die Positionen in Hinblick auf seine historische Einordnung indes kaum gegensätzlicher sein. Die Einschätzungen reichen dabei von einem „normalen Kolonialkrieg"2 bis hin zu „einem Völkermord, der nicht nur der erste Genozid des 20. Jahrhunderts war, sondern zugleich auch der erste der deutschen Geschichte"3. Letztere Position, die den Krieg als Genozid verstanden wissen will, ist die dominierende Sichtweise innerhalb der akademischen Geschichtsschreibung.4
Die erste Position dagegen wird vertreten von einigen rechtskonservativen Traditionalisten, die in absolut unkritischer und sehr verklärter Weise das Ansehen und die Ehre der ehemaligen Schutztruppen pflegen.5 Zu diesem Kreis kann auch der in Südafrika lebende Historiker und Publizist Claus Nordbruch gezählt werden, der mit seinen Publikationen das wohl prominenteste Sprachrohr dieser Position ist und dessen zentrale These lautet, daß „entgegen vielen zeitkonformen und politisch korrekten Verlautbarungen und Unterstellungen keine Greueltaten an den Herero stattgefunden" haben, und der „die allgemeine humanitäre Einstellung der Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen"6 betont.
Wichtiger aber als diese Ansicht eines kleinen Kreises vorwiegend bundesdeutscher Traditionalisten ist der Umstand, daß die Interpretation des „normalen Kolonialkriegs“ vor allem auch von deutschsprachigen Namibiern geteilt wird, die keinen Anteil haben am akademischen Diskurs, ihre Position aber in Leserbriefen und öffentlichen Diskussionsbeiträgen in Namibia vertreten.
Viele der auf ehemaligem Hereroland gelegenen Farmen sind heute im Besitz von Namibia-Deutschen. Auch wenn bereits vor 1904 große Gebiete des Hererolandes aufgekauft und von deutschen Farmern in Besitz genommen wurden, so war es doch der Kolonialkrieg von 1904, der erst die Voraussetzungen für die flächendeckende Enteignung des Hererolandes geschaffen hat.
Schon alleine deswegen haben Namibia-Deutsche einen besonderen, persönlichen Grund zur Auseinandersetzung mit dem Kolonialkrieg und der deutschen Kolonialvergangenheit in Namibia, und das unabhängig davon, ob es sich bei ihnen um direkte Nachkommen der ersten deutschen Siedler und Kolonisten handelt, oder ob sie erst in späteren Jahren in Südwestafrika/Namibia eingewandert sind. Denn eine derartige Differenzierung findet in der namibischen Öffentlichkeit nicht statt.
Die Ursachen für die kontroverse Beurteilung des Kolonialkrieges von 1904 sind vielschichtig. Zum Teil hängen diese damit zusammen, daß - entgegen einer weit verbreiteten Ansicht - selbst ereignisgeschichtliche Sachverhalte nicht ausreichend bekannt bzw. wissenschaftlich fundiert sind und deshalb Raum bieten für unterschiedliche Auslegungen. Die eigentlichen Hintergründe für diese Kontroverse sind aber an anderer Stelle zu suchen. Beide Gruppen sind darum bestrebt, die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Kolonialkrieg von 1904 in einen größeren, aber jeweils anderen Kontext einzuordnen.
Für die deutschsprachigen Namibier hat die Interpretation des Krieges einen starken biographischen, in jedem Falle persönlichen Bezug. Die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte und afrikanischen Vergangenheit ist grundlegend für ihr Selbstverständnis und ihre Positionierung im gegenwärtigen Namibia und damit in einer Gesellschaft, die über mehr als Hundert Jahre hinweg von Kolonialismus und Apartheid geprägt war. Die Vertreter der akademischen Position dagegen, die den Krieg als ersten deutschen Genozid verstanden wissen wollen, leben, lehren und schreiben fast ausschließlich in Europa.
Die Beschäftigung mit dem Kolonialkrieg von 1904 ist für sie in der Regel nicht von einer biographisch-persönlichen Dimension geprägt. Sie erfolgt deshalb weniger mit der Intention, durch die Interpretation der Vergangenheit zu einer Legitimation der namibischen Gegenwart zu gelangen, sondern sie interpretiert die Ereignisse in Deutsch-Südwestafrika zuallererst im Kontext einer deutschen Geschichte und ihm Rahmen eines europäisch-akademischen Wissenschaftsbetriebes.
Kernstück der unterschiedlichen Einordnung des Krieges ist die Genozid-Debatte, also die Frage, ob der Krieg von 1904 als Genozid bzw. Völkermord klassifiziert werden soll bzw. muß oder nicht, und ob die historischen Quellen in diese Richtung interpretiert werden sollen oder nicht. Die deutsche Geschichtsschreibung hat sich mit Kolonialgeschichte im Allgemeinen, und damit auch mit dem Thema der Kolonialkriege in Deutsch-Südwestafrika im Besonderen, lange Zeit nicht befaßt.
Im Dritten Reich fand der Krieg mit dem Volk der Herero nur vereinzelt Eingang in kolonialpropagandistische Schriften, die gegen die sogenannte .Kolonialschuldlüge' anschrieben und einem Kolonial-Revisionismus das Wort redeten.8 Die erste wissenschaftlich fundierte Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialvergangenheit in Südwestafrika, und dabei insbesondere auch mit dem Kolonialkrieg von 1904, erfolgte 1966, als der ostdeutsche Historiker Horst Drechsler seine wegweisende und bis heute äußerst einflußreiche Dissertation „Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft" vorlegte.
Drechsler war der erste Historiker, der den Begriff des Genozids auf den Kolonialkrieg von 1904 anwandte, indem er ihn als den ersten Krieg bezeichnete, „in dem der deutsche Imperialismus die Methoden des Genozids, in denen er es später zu trauriger Berühmtheit brachte, praktizierte."9
Seit Drechsler wird der Krieg von der akademischen Historiographie fast durchgängig als Genozid bezeichnet. Es sollte selbstverständlich sein, daß eine derart drastische Klassifizierung nur auf der Grundlage einer Definition erfolgen kann. Dennoch wird die Kategorie Genozid fast ausnahmslos verwendet, ohne in irgendeiner Weise thematisiert, geschweige denn näher bestimmt zu werden.
In aller Regel findet sich in akademischen Darstellungen nicht einmal ein Verweis darauf, daß der Begriff des Genozids in Bezug auf den Krieg von 1904 durchaus kontrovers diskutiert wird. Eine Ausnahme dazu bilden die im erkenntnistheoretischen Kontext einer (vergleichenden) Genozidforschung entstandenen Arbeiten von Jürgen Zimmerer. Zimmerer entwickelt seine Argumentation ausgehend von einer Definition, die von den Vereinten Nationen am 9. Dezember 1948 in der Genozidkonvention angenommen wurde. Darin heißt es in Artikel II:
In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
a. Tötung von Mitgliedern der Gruppe;
b. Verursachung von schwerem körperlichen oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe;
c. vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen;
d. Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind;
e. gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Es ließe sich trefflich streiten um den Sinn der Übertragung einer juristischen Kategorie von 1948 auf Ereignisse der Jahre 1904 und folgende. Die Bedeutung der 1948 geschaffenen juristischen Kategorie Genozid besteht unter anderem darin, daß die Feststellung der Situation eines Genozids mit einem Handlungsimperativ für die internationale Völkergemeinschaft verbunden ist. 1904 existierte das Konzept und eine entsprechende Verpflichtung zur Intervention nicht. Worin besteht dann aber der analytische Wert der Übertragung dieser Kategorie von 1948 auf den Kolonialkrieg von 1904? Eine Antwort darauf gibt Zimmerer, der in Bezug auf den Krieg urteilt:
„Er trug dazu bei, den Holocaust denkbar und möglich zu machen"". Es kann hier dahingestellt bleiben, ob diese Einschätzung zutreffend ist. Festzuhalten ist jedoch, daß jedenfalls aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive der analytische Wert der Kategorie Genozid, wenn überhaupt, dann für die Analyse und Interpretation der deutschen Geschichte von Bedeutung ist. Er ist aber nicht von Nutzen in Hinblick auf die Historiographie Namibias und trägt in keinster Weise bei zum Verständnis der Ereignisse der Jahre 1904 und folgende in Deutsch-Südwestafrika.
Akademische Historiographie seit Drechsler klassifiziert den Kolonialkrieg nicht zuletzt deshalb als deutschen Genozid, weil er „schon auf späteres verweisend"12 interpretiert werden müsse. Die Ereignisse in Deutsch-Südwestafrika werden in dieser Lesart aus einer deutsch- bzw. eurozentristischen Perspektive heraus bewertet. Wie sehr die Genozid-Debatte der akademischen Historiographie aus einer eurozentristischen Blickweise geführt wird, zeigt sich deutlich an der gebrauchten Terminologie. Bereits die überwiegende Verwendung des Begriffes im Singular, „Der Kolonialkrieg (1904-1908) in Namibia", so etwa der Titel der Publikation von Zimmerer und Zeller,13 und damit in Kontexten, die sowohl auf den Krieg mit dem Volk der Herero, als auch auf den Krieg mit dem Volk der Nama referieren, offenbart diese eurozentristische Perspektive:
Denn aus afrikanischer Sicht handelte es sich dabei zweifelsohne um zwei Kriege, den Herero Krieg und den Nama Krieg. Auf diese Weise werden der Herero-Deutsche und der Nama-Deutsche Krieg vereinnahmt als Teil der deutschen Geschichte und ausschließlich aus deutscher Perspektive heraus werden sie analysiert und dargestellt. Ein weiteres Detail ist bezeichnend: Akademische Historiker sprechen nicht von einem Krieg, der mit einem Volk ausgetragen wird, sondern gegen ein Volk. Durch diese Terminologie und Perspektive werden Afrikaner weitgehend als passive Opfer deutscher Aggression dargestellt, implizit wird ihnen damit Handlungsfähigkeit, vor allem aber die Initiative zum Krieg abgesprochen.14
Jenseits einer Diskussion um den analytischen Wert der Kategorie Genozid aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive, die hier nur ganz kurz angedeutet wurde, ist ein anderer Aspekt von ungleich größerem Gewicht für die Bewertung der Historiographie des Krieges. Er betrifft die Grundlagen, auf denen eine Klassifizierung als Genozid erfolgt. Entscheidend an obiger Definition von Genozid ist die Intention zum Verüben eines Völkermordes und nicht die im Sinne der Absicht erfolgreiche Durchführung. Aus diesem Grunde ist auch die eigentliche Anzahl der in Folge des Krieges zu Tode gekommenen Herero weder im Kontext der Genozid-Debatte, noch in Hinblick auf die an den Herero begangenen Grausamkeiten von Bedeutung, weil sie in keinster Weise zu irgendeiner Form von Relativierung dienen kann. Und dennoch - und das ist charakteristisch - wird diese Diskussion geführt.
Die Problematik der Bestimmung der Anzahl der zu Tode gekommenen Herero auf der Grundlage erheblich divergierender Volksschätzungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgten und auf sehr verschiedenen Angaben und Vermutungen beruhen, ist bestens bekannt und hinlänglich dokumentiert.15 Da weder die Gesamtzahl der Volkes der Herero vor Beginn des Kriegs, noch die Anzahl der Überlebenden bekannt ist, können schlicht keine seriösen Angaben über die Opfer des Krieges auf Seiten der Herero gemacht werden.
Trotz dieser ebenso einfachen, wie grundlegenden Tatsache aber, wird die Zahl der Toten von der akademischen Geschichtsschreibung, die den Krieg als Genozid verstanden wissen will, immer wieder mit 80 Prozent angegeben, manchmal mit Hinweis auf die Schätzung, manchmal auch als Faktum.16 Charakteristisch ist dieses Beharren auf Opferzahlen insofern, als es zeigt, daß akademische Historiographie des Krieges resistent ist gegen jede Form von Kritik. Es verweist damit auf ein schwerwiegendes Problem. Denn die Ignoranz berechtigter Einwände und begründeter Argumente erfolgt ganz bewußt:
Sie ist Ausdruck der Tendenziösität der akademischen Geschichtsschreibung. Tendenziös ist sie vor allem in zweierlei Hinsicht: Zum einen in ihrem unkritischen Umgang mit Quellentexten und Fachliteratur, die ihrerseits von einer bestimmten Sichtweise geprägt und tendenziös sind. Und zum anderen durch ihre Art und Weise der Auswertung, Interpretation und Darstellung von Quellentexten. Beiden Aspekten gebührt eine eingehende Betrachtung.
Kurze Diskussion der Quellentexte
Eine akademische Historiographie, welche die Ereignisse der Jahre 1904 und folgende als Völkermord klassifiziert, muß - unabhängig davon, ob diese Klassifizierung explizit auf der Grundlage einer Definition geschieht, wie etwa bei Zimmerer, oder aber implizit durch die Verwendung der entsprechenden sprachlichen Konzepte wie bei Gewald17 - bei der Untersuchung und Darstellung der Ereignisse ein besonderes Augenmerk auf den Nachweis der Intention zum Völkermord legen. Ein solcher Nachweis kann nur ausgehend von Quellentexten erfolgen.
Eine Diskussion der Quellen ist in speziell diesem Fall um so notwendiger, als die Landesarchive der deutschen Schutztruppe, die ohne Frage von zentraler Bedeutung in Hinblick auf die Genozid-Debatte wären, seit spätestens 1939 weder in Namibia noch in Südafrika mehr existieren, ohne daß die Umstände ihrer Vernichtung bekannt wären. Duplikate dieser Akten der Schutztruppe, die Bestandteil des deutschen Militärzentralarchivs in Berlin waren, wurden wahrscheinlich bei einem Bombenangriff im Februar 1945 zerstört.18 Insgesamt nur vier Kladden aus dem Aktenbestand der Schutztruppe in Deutsch-Südwestafrika sind erhalten.19
Einer der ältesten Quellentexte, mittels dessen von der akademischen Historiographie die Intention zum Völkermord aufgezeigt wird, ist das vielfach vollkommen unkritisch zitierte sogenannte Generalstabswerk.20 Noch vor dem offiziellen Ende der Kriege wurde von der kriegsgeschichtlichen Abteilung l des Großen Generalstabs in Berlin eine zweibändige, umfassende Darstellung der Kriegshandlungen mit dem Titel „Die Kämpfe der deutschen Truppen in Südwestafrika" vorgelegt. Der erste Band, „Der Feldzug gegen die Herero", wurde schon 1906 als Sonderabdruck aus den „Vierteljahresschriften für Truppenführung und Heereskunde" veröffentlicht. Über die Hintergründe und vor allem die der Darstellung zugrunde liegenden Quellen ist nur wenig bekannt.
Laut Untertitel wurde das Werk „auf Grund amtlichen Materials" erarbeitet. Im Text selbst finden sich nur wenige Literaturangaben, und an einigen Stellen Verweise auf Gewährsmänner, ohne daß diese Belege jedoch genauer spezifiziert werden. Durch das Fehlen der dem Werk zugrundeliegenden Materialien ist es nicht möglich, die Richtigkeit der Darstellung im Einzelnen zu prüfen, insbesondere dann, wenn über die rein ereignisgeschichtlichen Darstellungen hinausgehende, mit den militärischen Operationen verbundene Einschätzungen, Überlegungen, Strategien und Absichten angeführt werden.
Dieses Manko wiegt um so schwerer, als dem Generalstabswerk im Kontext der Versagensdiskussion der Schutztruppe, wie sie im Deutschen Reich geführt wurde, eine starke Tendenz unterstellt werden muß, den Verlauf des Krieges mit dem Volk der Herero als erfolgreiche militärische Strategie darzustellen. Das Vorwort zu Band l läßt keinen Zweifel an dieser Zielsetzung und erläutert die Absicht, die der Publikation zugrunde lag:
Die Leistungen der deutschen Truppen in den Kämpfen in Südwestafrika haben Anspruch auf den Dank des gesamten Vaterlandes. Der Generalstab hat es deshalb als seine Pflicht angesehen, mit einer Darstellung dieser Kämpfe bereits jetzt an die Öffentlichkeit zu treten, wenn auch zur Zeit der für eine völlig erschöpfende Bearbeitung erforderliche Quellenstoff noch nicht vorliegt. Besonderer Wert wurde hierbei darauf gelegt, dem deutschen Volke in gemeinverständlicher Form ein anschauliches Bild des entbehrungsvollen Lebens der Truppen im Felde und ihres tapferen Verhaltens im Gefecht zu geben.21
Vor diesem Hintergrund urteilte etwa Brigitte Lau in Bezug auf das Generalstabswerk: „Diesen unglückseligen Versuch, eine verwirrte, beziehungslose und teure militärische Situation zu rechtfertigen, als bare Münze zu nehmen - wie es auch viele zeitgenössische Kolonialschriftsteller taten, wahrscheinlich vom Drang beseelt, als Kriegshelden zu erscheinen - ist geschichtlicher Unsinn"22. Trotz offensichtlicher, dem Werk anzulastender Tendenziösität, die um so schwerwiegender zu veranschlagen ist, als die Darstellung nicht ohne weiteres überprüfbar ist, wird das Buch nach wie vor, und nicht nur für den Verlauf des Krieges, völlig unkritisch als historische Quelle verwendet.
So zitiert etwa Zimmerer zur Darstellung der schrecklichen Situation der Herero nach deren Flucht in die wasserlose Halbwüste Omaheke aus dem Generalstabswerk folgende Passage: „Kranke und hilflose Männer, Weiber und Kinder, die vor Erschöpfung zusammengebrochen waren, lagen, vor Durst schmachtend, in Massen [...] im Busch, willenlos und ihr Schicksal erwartend."23
Dieser unkritische Umgang mit dem Generalstabswerk ist insofern besonders bedenklich, als es eben nicht mehr möglich ist, die militärischen Operationen und die mit ihnen verfolgten Zielsetzungen auf der Grundlage von Aktenmaterial zu rekonstruieren. Es ist nicht ohne Ironie, daß durch die besondere Quellenlage die Darstellung des Generalstabs, die es sich explizit zum Ziel gesetzt hat, „ein anschauliches Bild des entbehrungsvollen Lebens der Truppen" zu zeichnen, unkritisch auch von jenen Autoren zitiert wird, die gerade gegen diesen „Opfermythos der Schutztruppe“ anschreiben und statt dessen den Schutztruppensoldaten die Intention zum Völkermord anlasten.
Neben dem Generalstabswerk, das in erster Linie als Quelle für die deutsche Kriegsführung von Bedeutung ist, wird durchgängig das sogenannten Blaubuch als einschlägige Quelle konsultiert, wenn es darum geht, die Verfehlungen deutscher Kolonialpolitik in Deutsch-Südwestafrika und die Grausamkeiten gegenüber der afrikanischen Bevölkerung nachzuweisen.24 Auch über den historischen Aussagewert dieser Quelle ließe sich trefflich streiten, so denn eine Diskussion darüber überhaupt geführt würde. Die Bewertung des Blaubuchs als historische Quelle ist jedoch in erster Linie nicht das Ergebnis einer argumentativ geführten Debatte, sondern vielmehr eine Art Glaubensfrage, die offenbar bestimmt wird von der eigenen erkenntnistheoretischen Zielsetzung der Autoren, die sich mit der deutschen Kolonialherrschaft in Südwestafrika beschäftigen.
Der Grund für die unterschiedliche Bewertung des Blaubuchs als historische Quelle liegt zunächst in dessen Entstehungsgeschichte. Im Herbst 1917, zwei Jahre nach der Eroberung Deutsch-Südwestafrikas durch die Truppen der Südafrikanischen Union, wurden zwei Beamte der südafrikanischen Besatzungsmacht damit beauftragt, Material zu sammeln und einen Bericht über die Behandlung der afrikanischen Bevölkerung während der deutschen Kolonialherrschaft abzufassen.
Das Ergebnis war der "Report on the Natives of South-West Africa and their Treatment by Germany", der bereits am 19. Januar 1918 (25) fertiggestellt war. Der Bericht besteht aus zwei Teilen: Der 139 Seiten umfassende Hauptteil wurde von dem als Militärmagistrat in Omaruru stationierten Major T. O'Reilly unter dem Titel "Natives and German Administration" verfaßt; für den zweiten, 50 Seiten umfassenden Teil mit dem Titel "Natives and the Criminal Law" zeichnete A. J. Waters verantwortlich, der seit Oktober 1915 als Generalstaatsanwalt für das Protektorat tätig war.26
Eile war geboten bei der Abfassung und Vorlage des Berichts, wie der damalige Administrator Gorges im Vorwort betont: "The time available for the collection of material for incorporation into this report and for the careful collation of that material has been brief."27 Gorges selbst erklärt nicht, warum diese Eile nötig war. Sie steht jedoch in Zusammenhang mit der Zielsetzung des Berichts, über die kein Zweifel besteht. Der Bericht sollte dazu dienen, die moralische Berechtigung und Befähigung Deutschlands zum Kolonialbesitz in Abrede zu stellen und auf diese Weise den Verzicht Deutschlands auf seine überseeischen Besitzungen zu rechtfertigen, wie er in Artikel 119 des Versailler Vertrags festgeschrieben wurde.28
Administrator Gorges selbst unterstreicht diese Zielsetzung des Berichts in seinem Vorwort, wenn er schreibt: "Enough should be found in this report to convince the most confirmed sceptic of the unsuitability of the Germans to control natives, and also to show him what can be expected if the unfortunate natives of this part of Africa are ever again handed back to the former regime."29 Die Erstellung des Blaubuchs diente in erster Linie propagandistischen Zwecken. Aus diesem Grunde wurde am 29. Juli 1926 eine Entschließung des südwestafrikanischen Landrats einstimmig angenommen, in der es u.a. heißt, daß der Report „nur die Bedeutung eines Kriegsinstrumentes hat, und daß die Zeit gekommen ist, dieses Instrument außer Wirkung zu bringen und alle Kopien dieses Blaubuches, die in offiziellen Akten und öffentlichen Büchereien dieses Gebietes sich befinden, auszuschließen und zu vernichten."30 Auf einen Antrag, entsprechend in Südafrika zu verfahren, antwortete der Sekretär des Premierministers Herzog in dessen Auftrag am 9. April 1929:
„Die Unzuverlässigkeit und Unwürdigkeit dieser Urkunde der Kriegshetze genügt nach Ansicht des Erstministers, sie zu dem schimpflichen Begräbnis aller verwandten Schriften der Kriegszeit zu verdammen."31
Noch mehr als dem Generalstabswerk muß dem Blaubuch eine deutliche Tendenziösität unterstellt werden, die an vielen Stellen des Textes aufgezeigt und festgemacht werden kann.32 Die Tendenziösität der Darstellung allein rechtfertigt aber noch nicht eine Abqualifizierung des Reports als „Lügenblaubuch“ ohne jeden historischen Quellenwert. Sie verlangt aber, wie jeder andere historische Quellentext auch, eine strenge quellenkritische Behand-lung.33
Vor allem vor diesem Hintergrund ist die Neu-Edition des Blaubuchs durch Silvester und Gewald (2003) als problematisch zu bewerten.34 Auf der einen Seite setzt die Verwendung gerade des Blaubuchs als historische Quelle eine fundierte Kenntnis geschichtswissenschaftlicher Methoden, allen voran der Quellenkritik, voraus. Hier wiegt das Versäumnis der Herausgeber einer kritischen, historischen Einordnung der einzelnen Darstellungen im Blaubuch schwer. Auf der anderen Seite setzt eine fundierte Quellenkritik den Zugang zu umfangreichem weiteren Quellenmaterial voraus, wie es etwa im Nationalarchiv Namibias und der namibischen Nationalbibliothek vorhanden ist, wo im übrigen aber auch das Original des Blaubuchs jederzeit einsehbar ist. Auch von dieser Seite ist eine Neu-Edition deshalb nicht gerechtfertigt.
Das Blaubuch vereinigt Material zweierlei Art, das deutlich voneinander zu unterscheiden ist. Zum einen fußt es auf der Auswertung von publizierter Literatur sowie des umfangreichen deutschen Aktenmaterials. In dieser Hinsicht ist das Blaubuch von großem referentiellem Wert. Die Tendenziösität der Darstellung macht aber die Einsicht der Publikationen und vor allem der Originalakten unerläßlich, auch wenn diese aufwendig ist, da die Belege im Blaubuch oft nicht derart eindeutig und spezifisch sind, als daß die Originaltextstellen leicht aufzufinden wären. Eine Einsichtnahme der Originaltexte ist aber schon deshalb unverzichtbar, weil alle dem Blaubuch zugrunde gelegten Dokumente und Publikationen in deutscher Sprache abgefaßt sind, diese jedoch im Blaubuch durchgängig nur in englischer Übersetzung wiedergegeben werden.
Von ungleich größerer Bedeutung mit Blick auf den Kolonialkrieg 1904 ist die zweite Textart, die im Blaubuch verzeichnet ist. Es handelt sich dabei um die Aussagen afrikanischer Zeitzeugen. Das Quellenmaterial zur afrikanischen Kolonialgeschichte ist fast ausschließlich europäischer Provenienz. Afrikanische Stimmen, welche die afrikanische Perspektive direkt zum Ausdruck bringen, sind sehr selten. Um so bedeutsamer sind die im Blaubuch auszugsweise verzeichneten Interviews von Afrikanern als kolonialgeschichtliche Quelle für die Zeit der deutschen Kolonialherrschaft. Auch diese Texte erfordern indes einen quellenkritischen Umgang, und gerade hierin liegt das Manko dieser Interviews begründet.
Denn über die Umstände dieser freiwilligen und unter Eid gemachten Aussagen, der Art und Weise, wie sie zustande kamen, ist fast nichts bekannt. So wissen wir weder, wie die Auswahl der Interviewten getroffen wurde, was deren Motivation zu ihrer Aussage war, noch welche Fragen man ihnen gestellt hatte. Wir wissen nichts über den sprachlichen Prozeß der Befragung, Transkription und Übersetzung (die Aussagen sind im Blaubuch in englischer Sprache wiedergegeben), noch nach welchen Kriterien Auszüge aus den Aussagen Eingang in das Blaubuch gefunden haben und, noch wichtiger, welche Passagen dabei unterdrückt wurden. Die vollständigen Interviews liegen nicht vor.
Aufgrund dieser Einschränkungen ist eine externe Quellenkritik, die genau diese Fragen berücksichtigen muß, nicht möglich. Die Interviews sind einzig einer internen Quellenkritik zugänglich, die nach Plausibilität und Konsistenz innerhalb der Aussagen fragt. Es liegt in der Natur der Sache, daß durch interne Quellenkritik allein Texte bisweilen als unglaubwürdig beurteilt werden können, nie jedoch umgekehrt die Historizität der in ihnen dargestellten Ereignisse Bestätigung erfahren kann. Die Bewertung der im Blaubuch publizierten afrikanischen Zeugenaussagen wird deshalb in weiten Teilen immer auch eine Glaubensfrage bleiben müssen. Darüber täuscht auch nicht das Vorwort der Neu-Herausgeber des Blaubuchs hinweg, wenn sie in Bezug auf die Motivation zur Erstellung des Berichts schreiben:
"... whilst this context obviously determined the particular selection of evidence and timing of the compilation of a highiy critical evaluation of German colonial ruie in Namibia, this does not mean nor suggest that the evidence presented in the Blue Book should be judged to be false."35
Daß sie aber richtig sind, ist damit ebensowenig gesagt. Wenn man jedoch das Blaubuch, und insbesondere die darin aufgezeichneten Interviews von Afrikanern grundsätzlich als historische Quelle gelten läßt, dann müssen diese Aussagen konsequenterweise Eingang in die eigene Argumentation finden und eventuell daraus resultierende Widersprüche thematisiert werden, anstatt sie einfach zu verschweigen. Daß gerade letzteres aber oftmals der Fall ist, wird sich nachfolgend verschiedentlich zeigen.
Die nach wie vor am meisten zitierte Referenz für die Historiographie des Herero-Deutschen Kolonialkrieges ist die von Horst Drechsler erstmals 1966 publizierte Dissertation Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft, die seitdem auch in englischer Sprache mehrere Auflagen erfahren hat. Das Werk von Drechsler ist nicht nur die erste bedeutsame wissenschaftliche Studie zu den Kolonialkriegen, gleichzeitig diente es für spätere Untersuchungen als eine der wichtigsten Quellen überhaupt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Viele der nach 1966 publizierten Abhandlungen, die sich mit dem Kolonialkrieg von 1904 beschäftigen, folgen in weiten Teilen seiner Argumentation und wiederholen die darin getroffene Auswahl an Zitaten und Belegen. Um so verwunderlicher ist es, daß von Seiten der akademischen Historiographie eine kritische Hinterfragung der Arbeit von Drechsler bisher kaum statt gefunden hat.
Drechslers Werk ist ganz der marxistischen Geschichtsphilosophie verpflichtet und muß im Kontext des Ost-West-Konflikts betrachtet werden, der hier in seiner innerdeutschen Austragung um die Bewertung der deutschen kolonialen Vergangenheit eine besondere Bedeutung erhält. So widmet sich Drechsler etwa der Frage, „ob es sich beim Beginn der deutschen Kolonialexpansion noch um vormonopolistische oder bereits um imperialistische Kolonialpolitik bzw. um eine Kolonialpolitik der Übergangszeit handelte" und versteht seine Reflexionen dazu als Beitrag „zur Klärung dieses theoretisch wichtigen Problems" 36.
Entscheidender jedoch als das marxistisch geprägte Geschichtsverständnis Drechslers in Hinblick auf eine Bewertung seiner Darstellung ist die Grundannahme seiner Untersuchung, nämlich daß „die deutsche Kolonialherrschaft, dem Charakter des besonders aggressiven deutschen Imperialismus entsprechend, für die Afrikaner besonders verhängnisvoll war"3 . Drechsler beschäftigt sich nicht mit vergleichenden Imperialismusstudien, sondern einzig mit der Kolonialherrschaft in Südwestafrika. Seine Einschätzung „des besonders aggressiven deutschen Imperialismus" kann deshalb nicht als das in der Einleitung vorweggenommene Ergebnis seiner Studie angesehen werden, sondern muß vielmehr als Ausgangspunkt seiner Untersuchungen verstanden werden. Seine Darstellung ist von dem Bemühen geprägt, den besonders aggressiven Charakter deutscher Kolonialherrschaft herauszustellen.
Auf welcher Quellengrundlage argumentiert Drechsler? Seine wichtigsten Quellen bilden die Archivbestände des Reichskolonialamtes, die sich im Besitz der DDR befanden.38 Drechsler hat keine Forschung in Namibia unternommen, weder hat er deutsche oder afrikanische Zeitzeugen befragt, was Anfang der 1960er Jahre durchaus noch im Bereich des Möglichen lag, noch hat er die im Staatsarchiv in Windhoek gelagerten Akten der deutschen Kolonialzeit gesichtet.39 Publizierte Memoirenliteratur läßt Drechsler als Quelle kaum gelten: „Leider steht die Qualität der bisher erschienenen Bücher in einem argen Mißverhältnis zu ihrer Quantität: Nahezu alle wurden von Kolonialbeamten, Offizieren, Farmern, Missionaren und Reisenden verfaßt. In ihnen wurden, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Erlebnisse geschildert und subjektive Eindrücke von Südwestafrika vermittelt, die wissenschaftlich kaum verwertbar sind."40
Insbesondere die Vielzahl der publizierten Erinnerungen von deutschen Kriegsteilnehmern bezeichnet Drechsler als „wissenschaftlich völlig unergiebig. Warum Erlebnisse und subjektive Eindrücke nicht als Quelle geeignet sein sollten, bleibt völlig unklar und ist aus heutigem Geschichtsverständnis kaum mehr nachvollziehbar. Welcher Text, so mag man sich verwundern, ist nicht subjektiv? Drechsler gibt darauf indirekt selbst eine Antwort, die im Lichte des oben gesagten, nicht aber bei Berücksichtigung seiner Grundannahme, überraschend ist, indem er zwei Quellen unkritisch hervorhebt.
Da ist zum einen die offizielle Darstellung des Kriegsverlaufes: „Für die militärische Seite der Aufstände kann man das sogenannte Generalstabswerk benutzen"42. Reflexionen, die auf einen kritischen Umgang mit diesem Werk schließen lassen, sucht man vergeblich. Anders bei der zweiten von Drechsler hervorgehobenen Darstellung, dem Blaubuch, daß er als ein Buch bezeichnet, „das der Wirklichkeit relativ nahe kommt" und „zum ersten Male ein ungeschminktes Bild von der deutschen Kolonialherrschaft über Südwestafrika und ihren Folgen"43 biete. Drechsler selbst verweist auf die Genese des Reports, weshalb „es den deutschen Imperialisten jedoch leicht [wurde], ihn als Propaganda abzutun"44.
Die besondere Entstehungsgeschichte des Blaubuchs beeinträchtigt aber für Drechsler nicht dessen Wert als zuverlässige Quelle: „Erst heute, wo der „Report“ an Hand der Akten des Reichskolonialamtes überprüft werden kann, ergibt sich, daß das englische Blaubuch eine weitgehend zuverlässige Quelle bietet, der Wahrheit jedenfalls wesentlich näher kommt als die zahlreichen deutschen Darstellungen alle zusammen, die ihm vorausgingen"45. Auch diese Einschätzung zeugt nicht von kritischer Distanz, hatte es doch Drechsler selbst als „besonders wichtig" bezeichnet, daß die Autoren des Blaubuchs „zahlreiche überlebende Afrikaner befragten"46. Dies gilt insbesondere für Kapitel 15 mit dem Titel, "How the Hereros were exterminated", in dem, abgesehen von einigen Zitaten aus dem Roman (!) von Frenssen47, ausschließlich Zeugenaussagen wiedergegeben sind.48 Gerade diese Aussagen, von denen noch die Rede sein wird, lassen sich aber an Hand der Akten des Reichskolonialamtes schwerlich bestätigen.
Die nach wie vor zentrale Bedeutung seines Buchs als Beitrag zur Historiographie und zugleich Quelle für heutige Darstellungen muß vor diesem Hintergrund kritisch in Frage gestellt werden, und dies um so mehr, als die Aktenbestände des Reichskolonialamtes, bis 1990 im Besitz der DDR, mittlerweile jedermann zugänglich sind. In welcher Weise hat das marxistische Geschichtsverständnis von Drechsler, gepaart mit seiner Hypothese des besonders aggressiven deutschen Imperialismus, seine eigene Selektion und Bewertung der Quellen bestimmt, und damit auch die Darstellungen all jener Historiker beeinflußt, die sich maßgeblich und unkritisch auf Drechsler beziehen? Dieser Frage wird nachfolgend genauer nachgegangen werden.
Tendenziösität akademischer Historiographie
Akademische Geschichtsschreibung erfolgt an vielen Stellen auf eine Art und Weise, die tendenziös bezeichnet werden muß. Gerade weil die genaueren Hintergründe, Umstände und der Verlauf des Kolonialkrieges von 1904 oftmals nicht ausreichend bekannt bzw. genügend wissenschaftlich fundiert sind und deshalb Raum bieten für unterschiedliche Auslegungen, sollten Schlußfolgerungen sehr sorgfältig getroffen und argumentativ überzeugend untermauert werden. Aktuelle akademische Historiographie, die weitgehend der Darstellung von Drechsler folgt und dessen Argumentation übernimmt, ist dagegen nicht weniger einseitig als die ihr zugrundeliegenden Quellen- texte selbst.
Diese tendenziöse Darstellungsweise ist gekennzeichnet und kommt zustande durch falsche, nicht ausreichende oder fehlende Belege und durch eine voreingenommene, verzerrte oder irreführende Auslegung von Textstellen. Tendenziös sind die Darstellungen aber vor allem durch die bewußt im Sinne der eigenen Hypothese getroffene Auswahl von Quellentexten und Belegen. Die eigentliche Kritik wendet sich weniger gegen die Verwendung des Generalstabswerks, des Blaubuchs und der Studie von Drechsler als Quelle, sondern vielmehr dagegen, wie Quellentexte gebraucht werden. Drechsler war in seinen Schlußfolgerungen oftmals sehr viel eindeutiger, als die von ihm zitierten Quellentexte, weshalb Brigitte Lau anmerkte: „Es muß betont werden, daß Drechslers Bericht so gut recherchiert ist, daß sein eigenes Material sogar die Einwände gegen seine Auffassung des Krieges unterstützt: Seine Forschungsresultate beinhalten viele Zweideutigkeiten, die wahrscheinlich die Wahrheit über diesen Krieg ausmachen."49
In dieser Hinsicht ist akademische Historiographie neueren Datums insofern vorsichtiger im Umgang mit Quellentexten, als daß diese sorgfältig ausgewählt werden. Dieser Selektion fallen nicht nur ganze Quellengattungen und Texte, insbesondere die vielfältige Memoirenliteratur, pauschal zum Opfer. Sie betrifft darüber hinaus auch die Unterdrückung jener, der eigenen Hypothese widersprechenden Passagen auch aus solchen Quellentexten, die in anderen Kontexten als zitierfähig und zuverlässig bewertet werden.
Mit anderen Worten: Neuere Arbeiten sind oftmals gekennzeichnet von einer bewußten Selektion von Textpassagen im Sinne der eigenen Hypothese in Verbindung mit der Unterschlagung derjenigen Texte und Textstellen, die der eigenen Analyse widersprechen. Einige wenige Beispiele mögen ausreichen, die Tendenziösität akademischer Geschichtsschreibung des Kolonialkrieges von 1904 zu verdeutlichen. Sie betreffen die Kriegsursachen, die von deutschen Soldaten gegenüber Herero begangenen Grausamkeiten und die Proklamation v. Trothas vom 2. Oktober 1904.
Die Kriegsursachen
Die einzelnen Darstellungen des Kolonialkrieges von 1904 sind in Bezug auf die Ursachen des Krieges durchaus divergent. In der Beurteilung von Drechsler, der darin weitgehend der Darstellung des Blaubuchs folgt, sind diese unzweifelhaft:
Die Ursachen des Aufstandes sind eindeutig: Die systematische Expropriation und ihre völlige Rechtlosigkeit hatten die Herero zur nationalen Erhebung gegen den deutschen Imperialismus getrieben. Die Herero konnten und wollten so nicht länger leben. Sie zogen es vor, kämpfend zu sterben, statt widerstandslos den Abschluß ihrer Expropriation abzuwarten.50
Eine etwas andere These bezüglich des Kriegsausbruchs vertritt Gewald, der ansonsten weitgehend der Darstellung von Drechsler folgt. Er vermutet den Hintergrund für den Kriegsbeginn in den Reservatsplänen des Gouvernements, die dazu geführt hätten, daß das Volk der Herero von deutschen Siedlern gewissermaßen zum Krieg gezwungen worden sei:
In dieser gegen die Reservatspläne gerichteten Stimmungslage forderten die Siedler das Recht, weiteres Land zu besetzen - ein Krieg zwischen den Herero und den Deutschen wurde zu einer „self-fulfilling prophecy". Der Deutsch-Herero Krieg war also nicht die Folge einer geplanten Erhebung der Herero gegen die deutsche Kolonialherrschaft; die Vorstellung von einem „Volksaufstand" existierte nur in den Köpfen der Deutschen. Auch Knappheit an Land auf Seiten der Herero war nicht der Kriegsgrund. [...] Das chauvinistische Auftreten der Siedler - eine Folge dieser Ansätze zu einer restriktiven Landpolitik - schuf ein Klima, das einen Kriegsausbruch fast unvermeidlich machte.5'
Noch deutlicher formuliert wurde diese These von Gewald in seiner Dissertation aus dem Jahre 1996:
Once legislation was passed limiting the amount of Herero land available for sale, German settlers were cut off from land. The jingoistic attitudes of the settlers and their sympathisers that resulted form this legislation, led to the creation of a climate wherein the outbreak of war became inevitable. [...] The Herero-German war broke out äs the result of settler paranoia coupled with the incompetence and panic of a German officer.52
Es kann an dieser Stelle darauf verzichtet werden, die These Gewalds in seiner gesamten Argumentationsstruktur zu analysieren. Anzumerken ist, daß diese Darstellung der Kriegsursachen nicht neu ist. Ein entsprechender Standpunkt findet sich bereits im Blaubuch: "It was the desire of the Germans to precipitate a general rebellion. The extermination of the Hereros and the confiscation of the cattle and sheep they still possessed was their main objective."53
Hier, wie in der Darstellung von Gewald, waren es nicht eigentlich die Herero, die den Krieg begannen, sondern dieser wurde ihnen von den Deutschen aufgezwungen.54 Diese Interpretation findet ihren Niederschlag in der von Gewald gewählten Terminologie: er spricht von einem „Deutsch-Herero Krieg" und nicht etwa umgekehrt.55 Wohl auch deshalb läßt Gewald die anfängliche Ermordung von 123 Deutschen unerwähnt - sie paßt nicht zu dem Bild, das er vom Kriegsbeginn zeichnet. [...]
Für die Wahl der beiden Tagebücher von Georg Hillebrecht und von Franz Ritter von Epp zur Publikation waren zwei Kriterien grundlegend. Zum einen sollte es sich um Echtzeittagebücher handeln, also um Aufzeichnungen, die in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu den beschriebenen Situationen und Ereignissen stehen. Damit schied nicht nur die gesamte Erinnerungsliteratur zum Herero-Krieg aus, sondern auch all jene Tagebücher, die zu einem späteren Zeitpunkt überarbeitet bzw. überhaupt erst auf der Grundlage von Notizen ausformuliert wurden. Mittels dieses Kriteriums soll gewährleistet sein, daß die Aufzeichnungen nicht von Bewertungen und Einschätzungen im Lichte späterer Erfahrungen überlagert wurden.
Zum anderen sollte es sich um Tagebücher handeln, deren Beginn noch vor den Kämpfen am Waterberg bzw. in Hamakari vom 11. August 1904 lag, und die auch anschließend weitergeführt wurden. Dieses Kriterium ist von der Überlegung bestimmt, daß Hamakari nicht nur eine deutliche Zensur im Kriegsverlauf, sondern auch in der Kriegstaktik und den Kriegszielen darstellt. Alle Autoren stimmen darin überein, daß der „eigentliche“ Krieg am 11. August beendet war und die Auseinandersetzung von da an in eine neue Phase trat. Auch in Hinblick auf die Genozid-Diskussion ist das Geschehen nach den Kämpfen am Waterberg von zentraler Bedeutung. Indem die Tagebucheinträge beide Abschnitte des Krieges umfassen, kann auf ihrer Grundlage der Fragestellung nachgegangen werden, inwieweit sich durch die veränderte Rolle und Funktion der Schutztruppe nach Hamakari auch die Sichtweise der Soldaten auf den Kolonialkrieg, die Bewertung der eigenen Rolle in diesem Krieg und das Selbstverständnis als Schutztruppensoldat gewandelt hat.
Die Kombination dieser beiden Kriterien - so sehr sie auch aus quellenkritischer und erkenntnistheoretischer Perspektive sinnvoll sind - hat die Anzahl der in Frage kommenden Tagebücher in einem nicht erwarteten Ausmaß reduziert. Im Nationalarchiv in Windhuk, in der Sam Cohen Bibliothek in Swakopmund, im Bundesarchiv in Koblenz und Berlin, im Militärarchiv in Freiburg, im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz in Berlin und im Bayerischen Hauptstaatsarchiv in München - dies die recherchierten Archive - gibt es eine ganze Reihe persönlicher Aufzeichnungen und Tagebücher bzw. Tagebuchfragmente ehemaliger Kriegsteilnehmer, die in vielerlei Hinsicht wertvolle Auf- und Rückschlüsse für die deutsche Kolonialgeschichte Namibias bieten können.
Die meisten dieser Schriften erfüllen aber nicht die beiden genannten Kriterien. Entsprechend der großen Zahl der im Krieg mit den Nama eingesetzten Soldaten sind auch viele der Kriegstagebücher erst nach dem 11. August begonnen worden. Andere Aufzeichnungen enden vor den Kämpfen am Waterberg und sind anschließend - und auch das ist bemerkenswert - aus nicht genannten Gründen nicht wieder aufgenommen worden. Bei einer dritten Kategorie von Texten schließlich handelt es sich nicht um eigentliche Tagebuchaufzeichnungen, sondern vielmehr um Erinnerungsberichte, die zum Teil Jahre und Jahrzehnte nach 1904 verfaßt wurden.
Von den sechs, von Krüger besprochenen Tagebüchern bzw. persönlichen Schriften' beispielsweise erfüllen nur zwei beide Kriterien: Zum einen das Tagebuch des Unteroffiziers Knoke, eine 36-seitige Abschrift einer handschriftlichen Urfassung, die mit dem 20. April beginnt und am l. Januar 1905 endet. Die Einträge nach dem Gefecht bei Hamakari, an dem Knoke bei einer Maschinengewehr-Abteilung teilgenommen hat, sind aber sehr knapp gehalten und füllen nur noch etwa über sieben Seiten im Gegensatz zu den 29 Seiten für den etwa gleich langen Zeitraum zuvor. Zum anderen das äußerst umfangreiche Tagebuch von Hauptmann Viktor Franke, das allein in 13 Bänden sein Leben in Deutsch-Südwestafrika von Mai 1896 bis August 1914 beschreibt, und das, um ihm gerecht zu werden, in seiner Gesamtheit analysiert werden sollte. Die anderen vier von Krüger ausgewerteten Tagebücher sind überarbeitet bzw. erst später geschrieben.
Die maschinenschriftliche Abschrift des sehr ausführlichen und umfangreichen Tagebuchs von Oberleutnant Eugen Stuhlmann umfaßt zwar die Zeit von Ende April 1904 bis 30. September 1905, wurde aber von ihm im Februar 1917 bearbeitet. Auch wenn Stuhlmann versichert, er „lasse den Wortlaut möglichst stehen", so ist doch das Ausmaß dieser Überarbeitung nicht bekannt. Die 30-seitigen Auszüge aus dem Tagebuch des Reiters Richard Christel umfassen die Jahre 1905 und 1906, auch der Zahlmeister Adolf Auffahrt kam erst im Dezember 1904 nach Südwestafrika. Die kurzen Einträge und wenigen Briefe von Artillerie-Offizier Gerhardt von Brünneck schließlich beginnen am 24. Mai und enden mit einer knappen, stichwortartigen Beschreibung der Ereignisse bis zum 15. August, wo die Aufzeichnungen unvermittelt abbrechen.
Die beiden Tagebücher von Hillebrecht und Epp werden hier zusammen publiziert, weil sie sich trotz oder gerade wegen ihrer Unterschiede in Stil und Inhalt bestens ergänzen und das breite Spektrum persönlicher, individueller Perzeptionen des Kolonialkrieges verdeutlichen. Ein Text voller Beobachtungen, Beschreibungen, Eindrücke, Ansichten und Reflexionen auf der einen Seite, militärisch knappe, präzise Aufzeichnungen weitgehend ohne persönliche Anmerkungen, die nur Wesentliches aus der militärischen Perspektive eines Soldaten festhalten, auf der anderen Seite.
Beide Tagebücher können, jedes für sich genommen, zu einer differenzierteren Wahrnehmung und Bewertung der Ereignisse des Jahres 1904 beitragen und die Argumentationsbasis verbreitern. Gerade die Zusammenschau beider Texte aber macht deutlich, daß eine verallgemeinernde Argumentation mit Blick auf die Rolle und das Verhalten der Schutztruppensoldaten der historischen Realität und der Vielfalt der einzelnen Charaktere nicht gerecht wird.
Oberarzt Georg Hillebrecht: Afrikanisches Tagebuch 1904 - 1995
Georg Hillebrecht wurde am 4. November 1874 in Benrath bei Düsseldorf als jüngster von zwei Brüdern und zwei Schwestern und Sohn eines Hofgärtners geboren. Wie viele der 1904 in Deutsch-Südwestafrika eingesetzten Schutztruppensoldaten hatte er als Mitglied des Ostasiatischen Expeditionskorps in China bei der Niederschlagung des Boxeraufstandes bereits erste Kolonialkriegserfahrung gesammelt, als er sich im Alter von 29 Jahre, noch unverheiratet, freiwillig als Arzt nach Deutsch-Südwestafrika meldete. Die immer wiederkehrenden Vergleiche von Situationen und Ereignissen in Südwestafrika mit seinen Asienerfahrungen sind ein deutliches Zeichen dafür, daß er ähnliche Vorstellungen und Erwartungen mit seinem Einsatz in Afrika verband. Hillebrecht beginnt sein Tagebuch „mitten im Golf von Biskaya" am 12. Juni 1904. Nach der Beschreibung der Überfahrt von Hamburg mit eintägigem Zwischenstop auf Las Palmas erreicht Hillebrecht Anfang Juli Swakopmund, das er am 20. Juli Richtung Karibib verläßt. Von dort macht er sich am l. August auf den Marsch Richtung Waterberg.
Nach den Kämpfen am Waterberg weist sein Tagebuch eine größere Lücke auf. Die ersten überlieferten Zeilen sind ein Brief an seine Familie vom 22. August, den er 80 km südlich vom Waterberg schreibt. Dann dauert es wiederum einen Monat bis zu den nächsten Aufzeichnungen. Am 20. September befindet er sich in Epukiro und berichtet in einem Brief an einen früheren Regimentskameraden davon, daß seine Abteilung die Herero seit deren Flucht nach der Schlacht von Hamakari beständig verfolgt hatte, ohne sie indes nochmals einholen zu können. In dem Brief kündigt er auch eine Expedition nach Ganas an, wo sich, durch eine 100 Kilometer wasserlose Strecke von Epukiro getrennt, Herero niedergelassen haben sollen. Wiederum vergehen drei Wochen bis zu den nächsten Zeilen, einem Brief an seine Familie vom 19. Oktober. Darin schreibt er, daß die „Hererohetze" für ihn nun ein Ende gefunden habe. Am 21. Oktober bricht Hillebrecht von Epukiro Richtung Windhuk auf, wo er am 6. November eintrifft. Nur sechs Tage später zieht er in den Krieg mit den Nama. Seit dem Gefecht von Kub vom 22. November an Typhus erkrankt, ist der Krieg damit für ihn zu Ende. Nach Lazarettaufenthalten in Kub und später Windhuk verläßt er am 13. März schließlich Deutsch-Südwestafrika Richtung Kapstadt und tritt seine Heimreise über Ostafrika an. Das Tagebuch endet mit einem Eintrag vom 15.5.1905 im Hafen von Suez.
Das Tagebuch von Georg Hillebrecht wird hier bis zu seiner Abreise von Swakopmund veröffentlicht. Die Grundlage für die Publikation ist eine maschinenschriftliche Abschrift des handschriftlichen Originals, die 1975 von seiner Tochter, Frau Dr. med. Telse Zimmermann, angefertigt wurde. Hillebrecht selbst hat das Tagebuch um Briefe an seine Familie und an einen Regimentskameraden namens Stifft ergänzt. Diese Briefe sind chronologisch in das Tagebuch eingefügt, aber hier durch Verwendung einer anderen Schriftart als ursprünglich nicht zum Tagebuch gehörend kenntlich gemacht.
Die Briefe stellen eine wichtige Ergänzung zum Text des Tagebuchs dar, weil sie von Erlebnissen und Eindrücken berichten, die im Tagebuch selbst fehlen, sei es, weil sie bewußt von Hillebrecht weggelassen wurden, sei es, weil die Aufzeichnungen verlorenen gegangen sind. In einem undatierten Brief an Stifft schreibt Hillebrecht: „Sie sollen schon wieder einen sehr langen Brief von mir bekommen [...]. Die versprochene Gefechtsstudie ist das nicht, die ist schon stenographisch zu umfangreich. Aber der Grund dieses „mich Lösens" ist sehr von Eigenliebe diktiert. Schreibt man nämlich lediglich Tagebuch, so ist das stets eine mehr oder weniger fade Chronik des Wohl und Wehe der eigenen Person, schreibt man lange Briefe nach Hause, so muß man manches fortlassen, weil sonst die Leute daheim zu viel Sorgen haben."
Hillebrecht hat sein „Afrikanisches Tagebuch" für sich selbst, zugleich aber auch für seine Familie als Adressat geschrieben, der er in größeren Abständen seine jeweils letzten Einträge zugesandt hat. Mit Datum des 31. Juli 04 etwa vermerkt er: „Ihr Lieben! Sende heute das Tagebuch ab, das alles Wissenswerte enthält. Wahrscheinlich wird jetzt für mehrere Wochen bis Monate keine Nachricht von mir kommen können, weil die Telegraphenlinien dienstlich stark besetzt sind!" Diesem doppelten Zweck seiner Aufzeichnungen, persönliches Tagebuch einerseits und Nachricht für seine Familie andererseits, trug Hillebrecht durch eine Besonderheit seiner Tagebuchführung Rechnung. Aus verstreuten Anmerkungen geht hervor, daß er die Einträge zunächst in einer stenographischen Kurzschrift verfaßte, die er bei Gelegenheit in Reinschrift übertrug. Einige wenige Passagen allerdings wurden von Hillebrecht nicht übertragen und konnten auch bei der Abschrift des Tagebuchs nicht entziffert werden. Offenbar hatte Hillebrecht eine unbekannte Kurzschrift verwendet, die nur ihm leserlich war. Da die Originalaufzeichnungen im Anschluß an die maschenschriftliche Abschrift vernichtet wurden, ist ein weiterer Versuch zur Übertragung dieser steno-graphischen Notizen nicht mehr möglich. Auf sie wird in dem Tagebuch an den entsprechenden Stellen hingewiesen.
In den Aufzeichnungen von Hillebrecht, die relativ regelmäßig auf täglicher Basis erfolgten, finden sich zwei größere Lücken. Die erste umschließt den langen Zeitraum zwischen 4. August und 21. Oktober 1904, aus dem nur drei Briefe erhalten sind. In einem Brief vom 19. Oktober äußert sich Hillebrecht über diese Zeit: „Briefe habe ich bisher wenig geschrieben. [...]. Oft war man auch so strapaziert, daß man froh war, ein paar stenographischer Tagebuchnotizen zu Papier zu bringen." Dieses und das obige Zitat aus dem Brief an Stifft zeigen aber, daß Hillebrecht auch in dieser Zeit Aufzeichnungen machte, die aber aus ungeklärten Gründen nicht Eingang in das Tagebuch gefunden haben und als verloren angesehen werden müssen. Eine zweite größere Lücke im Tagebuch betrifft die Zeit seiner Typhuserkrankung und seines Aufenthaltes im Lazarett in Kub vom 23. November bis zum 26. Dezember 04, in der Hillebrecht kein Tagebuch geführt hat - zu einförmig und monoton war der Alltag. Die Aufzeichnungen in Zusammenhang mit seinem Lazarettaufenthalt vom 21. bis 23. November sind die einzig erkennbaren, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sind.
Hillebrecht spricht in dem Tagebuch an verschiedenen Stellen von Photographien, Filmrollen und Postkarten, die er nach Hause geschickt hat. Dieses Material ist leider nicht mehr erhalten. Die einzigen noch existierenden Photographien sind jene, die Hillebrecht selbst ohne jeden Kommentar seinem Tagebuch beigefügt hat, und die auch hier mit veröffentlicht sind. Da die handschriftliche Originalfassung nicht mehr erhalten ist und die Publikation auf einer Abschrift basiert, sind Tippfehler, Abkürzungen, Orthographie und Interpunktion im Text zur besseren Lesart geringfügig verändert und vereinheitlicht worden. Anmerkungen in runden Klammern befinden sich so in der Original-Abschrift, eigene Anmerkungen sind durch eckige Klammem kenntlich gemacht. Unleserlichkeiten bzw. unsichere Lesart sind mit [?] markiert. Die Schreibweise der Ortsnamen wurde der Schreibweise angepaßt, wie sie auf der „Kriegskarte von Deutsch-Südwestafrika" (Berlin 1904) im Maßstab von 1:800.000 oder auf den Karten des Generalstabswerkes Verwendung fanden.
Georg Hillebrecht wirkte im Ersten Weltkrieg an verschiedenen Fronten als Spezialist in der Organisation des Lazarettwesens und wurde 1918 im Rang eines preußischen Generaloberarztes aus der Armee entlassen. 1919 ließ er sich mit finanzieller Hilfe seines Schwiegervaters - Hillebrecht hatte sich 1917 verheiratet - in Altona-Bahrenfeld bei Hamburg als praktischer Arzt nieder. Bei Ausbruch des Zweiten Weltkrieges meldete er sich im Alter von 65 Jahren erneut als Freiwilliger und war als Bezirkslazarettdirektor mit der Ausstattung von Lazarettschiffen und Lazarettzügen beauftragt. Noch als Folge seiner in Deutsch-Südwest erlittenen Typhuserkrankung war er schwer herzkrank. Hillebrecht starb am 6. August 1944 im Alter von 69 Jahren an einem Herzinfarkt.
Hauptmann Franz Ritter von Epp: Tagebuch 1904
Über Leben und Wirken von Franz Ritter von Epp geben allein vier biographische Monographien detaillierte Auskunft, drei aus der NS-Zeit und eine jüngeren Datums.2 Als Freikorpsführer „Befreier Münchens" von der Räterepublik 1919, als Mitglied der NSDAP seit 1928, als Reichsstatthalter in Bayern und Reichsleiter der NSDAP seit 1933 sowie als Leiter des wehrpolitischen Amtes der NSDAP und des zunächst kolonialpolitischen Referats und späteren Amtes der NSDAP seit 1932 bzw. 1934 hatte Epp während der NS-Zeit bis zum Ende der Nazi-Diktatur 1945 eine aktive politische Rolle an oberster Stelle inne, mit der sich die genannten biographischen Studien, freilich aus ganz unterschiedlichen Perspektiven, auseinandersetzen. Auch die Einordnung und Bewertung der südwestafrikanischen Erfahrungen für den späteren Lebensweg von Epp ist ein dabei diskutierter Aspekt, auf den an dieser Stelle nur hingewiesen werden soll. Epp starb am 31.12.1946 in einem Krankenhaus in München als Internierter der amerikanischen Besatzungsmacht.
Bei allen offensichtlichen Unterschieden in der Persönlichkeit von Franz Ritter von Epp und Georg Hillebrecht - nicht nur mit Blick auf den späteren Lebensweg - sind doch auch die Parallelen hinsichtlich der Zeit in Deutsch-südwestafrika auffällig. Franz Ritter von Epp wurde am 16.10.1868 in München geboren, war also bereits 35 Jahre alt, als er am 6. Februar 1904 Hamburg an Bord des Dampfers „Lucie Woermann" mit Ziel Deutsch-Südwestafrika verließ und damit wie Hillebrecht kein junger Soldat mehr. Wie Hillebrecht hatte auch Epp zuvor bei der Niederschlagung des „Boxeraufstandes" in Asien teilgenommen, wie Hillebrecht war er an den Kämpfen am Waterberg und der anschließenden Verfolgung der Herero beteiligt, und wie Hillebrecht erkrankte er daraufhin an Typhus bzw. einer typhusartigen Krankheit, so daß er am Kriegszug im Süden nicht mehr teilnahm.